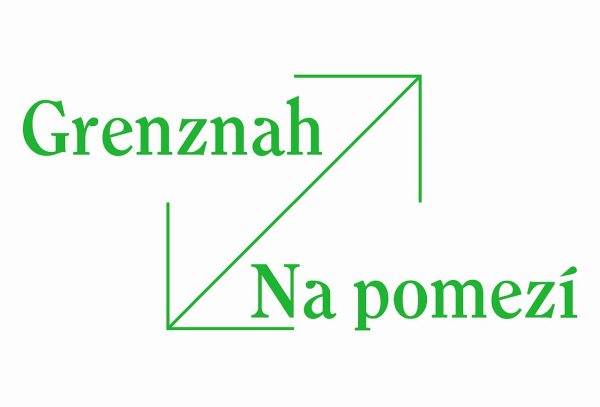Man muss nicht aus Tirschenreuth wegfahren, um gutes Theater zu erleben
Gespräch mit Florian Winklmüller
Herr Winklmüller, mir wurden Sie empfohlen als der Langhaarige, der ursprünglich aus München stammt.
Ich bin in München geboren, lebe aber schon seit sehr langer Zeit in Tirschenreuth, habe hier die Schule besucht und hier auch mein Abitur abgelegt. Aufgewachsen bin ich bei den Großeltern. Mein Großvater war Postbeamte und wurde nach Tirschenreuth versetzt. Ich wohne hier seit 1952, also fast mein ganzes Leben, weil ich Jahrgang 1948 bin. Während meines Studiums war ich weg, kehrte dann aber zurück. Der Grund dafür war meine Frau. Sie stammt von hier und wollte nie umziehen, wohin auch immer.
München lockt einen, oder? Warum wollte sie nirgendwohin?
Meine Frau ist bodenständiger als ich. Einige Male versuchte ich, sie woanders hin zu locken, aber immer vergebens. Ich habe in München und Regensburg studiert und danach versuchte ich, hier in der Gegend beruflich Fuß zu fassen. Als Lehrer habe ich in Nürnberg, Marktredwitz, Weiden, Neustadt an der Waldnaab und schließlich am Gymnasium in Tirschenreuth gearbeitet.
Welche Unterrichtsfächer haben sie gelehrt?
Wirtschaftsund Rechtslehre, Wirtschaftsinformatik, Geographie und Mathematik.
Das ist alles weit weg von der Rolle eines langhaarigen Jesus in den Passionsspielen, die Ihnen hierin Tirschenreuth den Beinamen Jesus verdient hat. Wie haben überhaupt Ihre langen Haare hier im konservativen Tirschenreuth gewirkt?
Rund um 1968 war ich in Tirschenreuth einer der ersten Männer mit langem Haar. Die Menschen betrachteten mich damals mit Erstaunen, manchmal auch mit mäßigem Zorn. Der Vater meiner späteren Frau hat zu ihr gesagt: „Komm mir mit keinem Langhaarigen ins Haus!“ Zu der Zeit aber, als ich Jesus gespielt habe, war langes Haar kein Problem mehr. Und als ich hier am Gymnasium gelehrt habe, war niemand mehr erstaunt. Die Zeiten haben sich seit den Sechzigerjahren geändert.
Es ist doch interessant, dass Sie sich in den Kopf gesetzt haben, lange Haare zu tragen, die seinerzeit zum Symbol des Protestes und des Freidenkertums der Blumenkinder wurden. Ende der Sechzigerjahre war ja in Tirschenreuth bestimmt alles in vollkommener Ordnung…
Wir haben damals z.B. die Beatles und Rolling Stones gehört. Die haben mit ihren langen Haaren die Revolte und den Willen symbolisiert, sich von den alten und muffigen Verhältnissen befreien zu wollen. Wir, junge Leute in Tirschenreuth, haben es genauso empfunden. Wir wollten freier sein, Schluss machen mit den Zeiten, in denen es vor allem galt, gehorsam zu sein. Wir haben die Lehrer in der Schule auf eine Art und Weise gefragt, die vorher ungewöhnlich war. Bei einigen fanden wir offene Reaktionen, bei anderen war es schwieriger.
Haben sie die berühmten Fragen nach der nationalsozialistischen Vergangenheit gestellt, oder noch einige andere?
Selbstverständlich ging es um Fragen bezüglich des Nationalsozialismus, doch in keinem Fall nur um sie. In der Schule erfuhren wir darüber nur sehr wenig, einfach ein Minimum, und das wollten wir ändern. Es ging aber allgemein um die Frage der Beziehung zwischen Vorgesetzten und Untergeordneten, zwischen Herrschenden und Beherrschten. Wir waren gegen den Vietnam-Krieg, Martin Luther King hat uns interessiert. Es war klar, dass es für uns nicht mehr möglich ist, irgendeiner Obrigkeit oder irgendwelchen Politiker nur so, ohne weiteres zu folgen. Der Mensch soll selber denken, seine Meinung äußern und durchsetzen. Er muss zu fragen wissen, was verbirgt sich hinter dem ersten Eindruck und hinter dem Anschein der Dinge.
Ich kann es mir vorstellen im Rahmen der großen Geschichte, habe aber Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie Sie mit dem Nachhall der großen Geschichte in einer nicht gerade großen Stadt umgegangen sind, wo fast alle die Kirche besuchen und man den Rhythmus einer durch Landwirtschaft geformter Region spürt. Verdienten Sie sich damit mindestens eine herabgesetzte Betragensnote?
Nein, das nicht. Wir haben keinen Konflikt gesucht, wir wollten die Veränderung. Wir haben unseren Lehrern erklärt, dass sie unsere Fragen ernst nehmen sollten, dass wir wirklich Antworten wollten. Wir ließen uns nicht einfach mit Klischees abspeisen. Wir haben glasklar kundgetan, dass unsere Beziehung zur Autorität und zum Nachfolgen der Autorität anders sei, als es bisher üblich war. Wir wollten wissen, warum bestimmte Dinge passieren, und wie man sie verhindern könnte.
Könnten Sie trotzdem irgendeinen Konflikt und irgendeinen Erfolg in diesen Zusammenstößen beschreiben?
Einen Erfolg haben wir gespürt, wenn wir bei unseren Lehrern Verständnis fanden. Wenn sie bereit waren, etwas zu ändern, und sie waren sogar froh, dass wir uns aktiv in die Lehrmethoden eingemischt haben. Konflikte entstanden eher mit manchen älteren Leuten, die die gewohnten Wege beibehalten wollten. Die sich nicht interessierten für jemand, der ihnen sagt, dass man auch anders denken und sogar lange Haare tragen kann. Es waren aber nicht solche Konflikte wie in den großen Städten.
Sind Sie damals in die Kirche gegangen? Wie hat sie auf die Änderungen um das Jahr 68 reagiert?
Ich bin in die Kirche gegangen, habe auch ministriert, und bin bis heute auch ein gläubiger Christ. Meinem Großvater lag viel daran, dass ich in die Kirche gehe. In den Sechzigerjahren waren meine Kirchenbesuche nicht mehr so regelmäßig, wir trafen uns am Sonntag mit den Freunden und unterhielten uns. Die Rolle der Kirche ist in Bayern bis heute groß, aber seit den Sechzigerjahren nimmt die Zahl der Geistlichen zu, die die Veränderungen wahrnehmen und sich auch über eine neue Rolle der Kirche in einer sich ändernden Gesellschaft Gedanken machen.
Wie sind Sie zum Theater gekommen? Haben Sie seit ihrer Jugend gespielt?
Als junger Mensch war ich eher beim Sport, ich spielte Handball und war später auch Handballtrainer. Zum Theater bin ich relativ spät gekommen, im Jahre 1994. Die Stadt Tirschenreuth wollte, wie auch andere Städte zu der Zeit, ein historisches Theaterstück zu einem Thema aus der Stadtgeschichte aufführen. Man suchte in der Geschichte der Stadt etwas, was eine dramatische Verwicklung vertragen würde. Es bot sich eine Geschichte um den Bezirkshauptmann Windsheim an, der die Tirschenreuther schikanierte und schließlich von ihnen getötet wurde. Herr Johannes Reitmeier hat auf der Grundlage dieser historischen Begebenheit ein Theaterstück geschrieben. Auf Aufforderung der Stadt sollten sich Leute melden, die gerne Theater spielen würden. Ich bin dorthin gegangen, das Treffen fand hier gegenüber unserem Haus statt. Herr Reitmeier hat mich wahrlich begeistert, als er seine Vorstellungen darüber präsentierte, wie das in einem Theaterstück umgesetzt werden soll. So entstand eine Theatergruppe, und Herr Regisseur Reitmeier sagte uns, er möchte mit uns ein Passionsspiel im Dialekt einstudieren. So entstanden die Tirschenreuther Passionsspiele. Herr Reitmeier fragte mich, ob ich Jesus spielen würde, und ich sagte ja, falls er mir eine so große und tragende Rolle zutraut. Nach dem Erfolg studierte er mit uns ebenfalls im Dialekt Jedermann ein. Dieses Stück wird zwischen den Passionsspielen gespielt, alle fünf Jahre Passionsspiele, und dazwischen ebenfalls alle fünf Jahre Jedermann. Die Passionsspiele und das Schauspiel Jedermann sind eine Veranstaltung der Stadt Tirschenreuth, genauso wie das erste Spiel, das Windsheims Tod heißt.
Sobald man mit dem Theater anfängt, will man weitermachen. Deshalb gründeten wir den Theaterverein „Modernes Theater Tirschenreuth“. Seit der Zeit haben wir eine Reihe Theaterstücke mit professionellen Regisseuren realisiert. Wir haben im Luitpoldtheater, einem ehemaligen Kino, gespielt, wo wir aber heute leider nicht mehr spielen können. Das alte Kino müsste aufwendig renoviert werden. Am Anfang gab es also die Initiative der Stadt, dann hat sich das Theater selbst weiterentwickelt. Man rief zum Beispiel aus Bärnau an, dass man Schauspieler bräuchte, um auch dort ein historisches Stück aufführen zu können. Dort habe ich den Regisseur Nikol Putz kennengelernt. Er hat mir gesagt, dass er gerne mit uns weiterhin zusammenarbeiten würde. Wir haben ein Stück einstudiert, das hier in Tirschenreuth einen realen Hintergrund hat. Es heißt im Dialekt Stoapfalz, also Steinpfalz.
Das Spiel wurde von Herrn Horst Wolf Müller geschrieben, der aus Schlesien stammt und einige Zeit in Tirschenreuth gelebt hat. Es handelt von einem polnischen Gefangenen, der im nahen Konzentrationslager Flossenbürg befreit wurde und sich auf den Weg nach Hause begab. Hier in Tirschenreuth ging er an einem Bauernhof vorbei, klopfte an und fragte, ob man für ihn Arbeit hätte. Er wurde aufgenommen und verliebte sich in die Tochter des Bauern. Der Bauer war mit dem fleißigen Mann sehr zufrieden, und er hatte auch nichts gegen die Liaison. Die Beziehung war aber ein Dorn im Auge mancher Nachbarn. Sie verleumdeten ihn, dass es ihm nur um den Hof ginge, und drängten den Bauern so lange, bis es der Pole nicht mehr aushielt und beschloss, weg zu gehen. Die Tochter war inzwischen schon schwanger, obwohl die beiden noch nicht verheiratet waren. Der Pole wollte sie mitnehmen, versuchte sie zu überzeugen, dass man hier keine Zukunft hätte, weil die Dorfbewohner ihn nicht mochten. Doch sie blieb, wurde schließlich verrückt und hat am Ende das geborene Kind getötet. Es war ein starkes Stück, als Anfang der Arbeit des Vereins „Modernes Theater Tirschenreuth“.
Das klingt wie ein ziemlich existenzielles Stück. Ich weiß nicht, wie ich es als ein Bauersmann aus der Tirschenreuther Gegend beurteilen würde. Wie wurde es angenommen?
Die Familie des Mädchens, der Hauptfigur, ist nicht ins Theater gekommen. Das Stück wurde aber ausgezeichnet angenommen, wir haben es zwei Jahre gespielt, auch in Weiden.
Sie sagen „auch in Weiden“. Wie sieht ein normales Leben eines in Tirschenreuth einstudierten Stück aus? Wie viele Leute kommen, wie viele Wiederaufnahmen erlebt es?
Es gibt kein normales Leben eines Theaterstückes. Zuerst diskutieren wir, was gespielt wird. Dann wird ein Regisseur gesucht. Gewöhnlicherweise spielen wir in Tirschenreuth. Das Publikum kommt zu uns auch von woanders her, auch aus mehr oder weniger weiter entfernten Orten. Wir haben uns einen guten Ruf aufgebaut und brauchen das Interesse der Zuschauer, denn die Zusammenarbeit mit den professionellen Regisseuren ist für uns natürlich eine finanzielle Belastung, die wir aus dem Eintrittsgeld finanzieren müssen. Unsere letzte Vorstellung in diesem Jahr hieß Sein oder nicht sein, eine schwarze Komödie darüber, wie sich eine polnische Theatergruppe im Jahre 1939 bemüht, vor den Nationalsozialisten nach Amerika zu fliehen. Die Gruppe setzt ihr Theatertalent ein, um die Nazis zu überlisten und aus Polen fliehen zu können. Wir haben fünf Vorstellungen gespielt. Im Saal waren 260 Plätze, aber diesmal war es nicht ausverkauft. Das Stück Stoapfalz spielten wir noch in dem vorher erwähnten Kino, wo etwa 150 Leute Platz finden, und haben zehn Reprisen erzielt. Im nächsten Jahr haben wir dann das Stück noch öfters wiederholt. Manche Theaterstücke setzen sich sehr gut durch, andere weniger gut, aber fünf Aufführungen erreicht jedes. Wir kümmern uns auch darum, Themen aufzugreifen, die für uns und für die Zuschauer interessant und wichtig sind, uns aber auch finanziell aufrechterhalten. Wir haben z.B. auch das Stück Hotel zu den zwei Welten gespielt. Jemand liegt auf der Erde im Koma, aber noch ist er nicht tot. Er befindet sich in einer Art Zwischenwelt, wo sich alle treffen, die nicht wissen, ob sie noch zurück auf die Erde kommen, oder weitergehen werden. Alle besprechen ihr Schicksal. Dann fällt die Entscheidung und einer nach dem anderen steigt in einen Aufzug ein, in dem ein Pfeil entweder nach oben oder nach unten zeigt. Es ist ein schönes Stück, in dem sich völlig verschiedene persönliche Schicksale treffen und verschiedene Sympathien und Antipathien zum Ausdruck gebracht werden.
Alles, was sie genannt haben, immer anders, sind schwere Themen. Wie wählen Sie die Stücke aus?
Ich lese viel und schlage dann solche Theaterstücke vor, von denen ich glaube, dass sie unser Publikum ansprechen könnten. Manchmal bekommen wir auch Empfehlungen von den Regisseuren. Bei einer Stückauswahl muss man auch darauf achten, dass man genug und entsprechend geeignete Schauspieler hat. In unserem Verein haben wir 110 männlicher und weiblicher Mitglieder, doch nicht alle spielen aktiv. In unserem letzten Stück traten 15 Leute auf der Bühne auf und man braucht dann auch noch viele Leute vor und hinter der Bühne.
Sie finden ein Theaterstück und sagen den Kolleginnen und Kollegen: „Ich habe wieder etwas, worin man die wichtigsten Themen und menschlichen Zweifel löst.“ Wie reagieren die Leute?
Wir haben eine Vorstandschaft, die über den Vorschlag diskutiert. Leute in Tirschenreuth fragen uns oft schon vorher, was wir für die Zukunft vorbereiten. Dann wird der Regisseur gesucht, den das ausgewählte Stück ansprechen kann.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit einem Regisseur aus? Er zieht nach Tirschenreuth um und arbeitet einige Monate mit euch?
Es begann mit Herrn Putz, mit dem wir fünf Schauspiele vorbereiteten. Während unserer Arbeit entstanden Kontakte zu weiteren Profis. Auch kommen Regisseure manchmal von sich aus zu uns mit dem Angebot, eine Inszenierung mit uns gestalten zu wollen. Es ist kein Problem, Leute nach Tirschenreuth zu bekommen.
Wie lange dauert die Vorbereitung eines Theaterstückes?
Das ist verschieden. Wir haben mit Regisseuren zusammengearbeitet, die hierher eingezogen sind, aber auch mit solchen, die in der Umgebung von bis dreißig Kilometer pendelten. Der Regisseur macht immer den Probenplan. Die Vorbereitung dauert etwa zwei bis drei Monate. Man beginnt mit den Leseproben, es folgen die Stellproben, man bildet die Szenen, die der Regisseur entwirft, man sieht sich nach den Requisiten und Kostümen um, das Bühnenbild muss gebaut werden und man überlegt, wie die Schauspieler geschminkt werden müssen. Beim letzten Stück begannen wir mit den Proben im September und im November war die Premiere. Wir arbeiten auch immer mit Musik, um die muss man sich auch kümmern. Manche können sagen, es sei zu viel Arbeit für nur fünf Reprisen. Aber wir haben unsere Vorstellungen von der Qualität, die wir zeigen wollen, und die entsteht nicht ohne lange Vorbereitungsarbeit mit guten Leuten. Unsere Schauspieler wollen das Publikum überzeugen, es hat das Recht, eine gute Leistung zu bekommen. In all den Jahren erfreuen wir uns wirklich eines guten Rufes. Den wollen wir nicht aufs Spiel setzen, denn sobald man einmal etwas verdirbt, muss man sich lange bemühen, um den guten Ruf wieder zurück zu gewinnen.
Was heißt es für Sie, die Qualität? Wenn ich Sie höre, und habe keine Ihrer Aufführungen gesehen, so widmen Sie sich den eher für das intellektuelle Publikum festgelegten Themen. Wer ist also Ihre Zielgruppe und was sind für Sie die Merkmale der Qualität?
Wir wollen ein anspruchsvolles Theater machen, damit Leute aus dem Saal herauskommen und das Bedürfnis haben, über das Stück zu reden. Wir wollen keine oberflächliche Unterhaltung. Unser Ziel ist es, bei den Leuten die Neugier auf Theater und interessante Inhalte zu wecken.
Aber das, was sie anbieten, ist nicht gerade bequem…
Was heißt bequem? Mir machen diese Themen Spaß. Man lernt dabei selber viel, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. Wenn Sie Theater spielen, behandeln Sie ein bestimmtes Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Wenn ich eine bestimmte Rolle spiele, muss ich ein Thema oder einen Konflikt nicht aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht dessen zeigen, den ich darstelle. Ich muss es für die andere Figur und für das Publikum verständlich spielen. Dasselbe brauchen wir in der Realität. Nicht vorher eine gegebene Einstellung à la „so war es immer und so wird es bleiben“ haben, sondern sich redliche Mühe geben und sich jedes beliebige Thema aus verschiedenen Sichtwinkeln anzuschauen. Man beschäftigt sich dann mit der Frage, warum jemand bestimmte Dinge anders sieht als ich. Deshalb bin ich überzeugt, dass das Theater für junge Leute sehr lohnenswert ist. Ich glaube, dass das Theater ein Pflichtgegenstand in den Schulen sein sollte. Junge Leute sollten zuerst sich selbst kennenlernen, ihr Selbstbewusstsein stärken, die Fähigkeit gewinnen, sich auf dem Podium vor andere Leute zu stellen, sei es zehn, fünfzig oder mehr als hundert. Das Theater braucht Teamarbeit, hier hilft man sich gegenseitig. Es nützt nichts, wenn Sie einen vortrefflichen Schauspieler, einen Star haben, die anderen aber schwach sind.
Ich würde gerne noch zu den Passionsspielen in Tirschenreuth zurückkehren, wenn Sie gestatten. Es gibt ein internationales Netz der Städte, welche Passionsspiele aufführen, wo sie gelesen werden. Glauben Sie, dass Sie zur Werbung für Ihre Stadt beitragen?
Es gibt eine Organisation, die den Namen Europassion trägt. Sie vereinigt Städte, die Passionsspiele aufführen. In der Tschechischen Republik werden Passionsspiele zum Beispiel in Höritz im Böhmerwalde / Hořice na Šumavě gespielt. Im Jahre 2020 wird sich Tirschenreuth freuen, eine große Europassion willkommen zu heißen, wo sich Vertreter der Passionsspiele aus verschiedenen europäischen Städten treffen werden. Ich selbst habe auch verschiedene Passionsspielorte besucht. Es ist eine erstaunliche Gemeinschaft, die sich regelmäßig trifft und Erfahrungen austauscht. Dieses bevorstehende Treffen in Tirschenreuth freut uns sehr. Selbstverständlich ist es eine gute Werbung für die Stadt, denn solche Veranstaltungen haben internationale Publizität. Die Passionsspiele locken regelmäßig Besucher aus fernster Umgebung herbei, sodass man sagen kann, dass die Stadt sich dank dieser regelmäßigen Veranstaltungen sehr gut profiliert.
Glauben Sie, dass die Stadt zufrieden ist, dass sie eine Theateraktivität initiiert hat, aus der auch Ihr Verein herausgewachsen ist?
Ich bin mir sicher, dass die Stadt damit zufrieden ist. Unsere Stadt unterstützt programmatisch verschiedene Bedürfnisse der hier lebenden Menschen. Das Kulturbedürfnis gehört dazu. Die Stadt nimmt bestimmt das Lob wahr, dessen sich das Theater erfreut. Die Medien wunderten sich auch, dass es in einer kleinen Stadt ein Theater auf so hohem Niveau gibt. Kurz gesagt, man muss nicht unbedingt in größere Städte fahren, um gutes Theater zu erleben.
Worin ist für Sie Tirschenreuth charakteristisch im Vergleich mit den anderen deutschen Städten? Wie nehmen Sie sie als eine Heimat wahr, in Bayern, in einem Land, das sogar ein Heimatministerium errichtet hat? Wie nahmen Sie früher die nahe Grenze wahr und wie tun Sie es heute?
Die Heimat hat mit diesem Ministerium wenig zu tun. Heimat ist für mich der Ort, wo ich hingehöre, wo ich mich wohl fühle. Und Tirschenreuth ist solch ein Ort für mich. Wir leben hier mit meiner Frau, weil wir hier leben wollen. Unsere Söhne sind wegen ihrer Arbeit weg, doch sie besuchen uns. Uns gefällt das hiesige Leben. Wenn wir in andere Länder reisen, kehren wir immer gerne zurück. Auf diesen Reisen versichern wir uns unter anderem immer, dass wir viele schöne Gegenden auch hier haben, zu Hause. Tirschenreuth hat sich in der letzten Zeit sehr zu seinem Vorteil verändert. Die Promenade entlang des Teiches im Zentrum der Stadt ist einmalig, man kann in der nahen Gegend schöne Spaziergänge machen, die Kultur bietet sich auch in vielen Richtungen um uns an. Das schöne Waldnaabtal eignet sich für wunderbare Sommerausflüge. Es gibt auch schöne Radwege, viele Bademöglichkeiten und ein vielfältiges Sportangebot.
Die nahe Grenze machte in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durch. Zur Zeit meiner Jugend war sie gesperrt, man sprach vom „Eisernen Vorhang.“ Von hier aus ist die Grenze nicht weiter als fünfzehn Kilometer Luftlinie. Ich war neugierig, was auf der anderen Seite passiert. Die Nachrichten, die ich hier und da erfahren habe, jagten mir Angst ein. Ich nahm die Existenz der Grenze als eine ständige latente Bedrohung wahr. Meine Bekannten gingen zum Beispiel einmal Pilze suchen und aus Versehen überquerten sie die Grenze. Sie wurden verhaftet und die ganze Nacht irgendwo festgehalten. Bei Mähring wurde ein deutscher Offizier erschossen, der dort spazieren ging. In der Tschechoslowakei war ich noch zu der Zeit des Eisernen Vorhangs. Ich leitete sogar als Vorsitzender des Personalrates etliche Reisen nach Prag. Ich begegnete dort offenen und liebenswürdigen Menschen. Das war ein Gegenerlebnis im Vergleich mit der Grenze, wo man penibel kontrolliert wurde und aus dem Bus aussteigen und Fragen beantworten musste, was man gekauft hat oder ob man dem Pflichtaustausch nachgekommen war. Damals hörte ich von dem Versuch, in einem entführten Bus aus der Tschechoslowakei zu flüchten. Die Grenze war von einem eigentümlichen Gefühl umgeben, obwohl ich auch eine lustige Geschichte erlebt habe, als ich nach Karlsbad gefahren bin mit einem Mann, der mit den Zöllnern Spaß machte und sie mit kleinen Geschenken zu bestechen versuchte. Er brachte Antiquitäten herüber und wollte, dass sie ihn nicht kontrollierten. Die Zöllner fragten ihn nur scherzhaft, was er wieder schmuggele, und ließen ihn durch. Als der Eiserne Vorhang gefallen ist, war es schön, in das Nachbarland fahren und sich alles ansehen zu können.
Die heutige Situation erinnert an die längst vergangene Jahre, als sich Leute aus beiden Seiten der Grenze noch frei trafen und Erfahrungen austauschten. Man fährt wieder in beiden Richtungen hinüber und herüber, um im anderen Land zu arbeiten. Die Deutschen fahren längst nicht mehr nach Böhmen, um dort nur billiger zu tanken. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute von uns nach Böhmen fahren, um das dortige Leben und die dortige Kultur kennenzulernen. Meine Schwiegermutter hat mir erzählt, wie Eger vor dem Krieg das Zentrum der ganzen Region war. Damals gab es keine Sprachgrenze, man redete in Eger deutsch. Meine Schwiegermutter besuchte dort ihre Friseurin. Man fuhr nach Eger, um dort auf dem Gymnasium zu studieren, oder zum Fotografen zu gehen. So eine große Annäherung wird man nicht so bald wieder erreichen, schon wegen der Sprache, aber soweit ich es beurteilen kann, nähern sich beide Seiten wieder einander an. Ich selbst habe auch in Böhmen und mit Tschechen Theater gespielt, und dann plauderten wir beim Bier. So wie es unter Schauspielern sein soll.