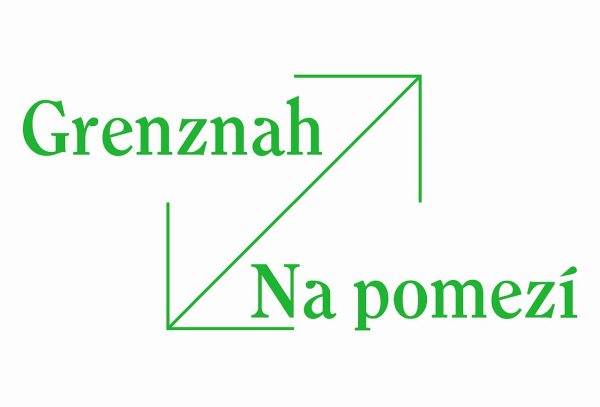Ein lebendiges Zeichen dafür, dass es sich lohnen wird, die Kirche instantzusetzen
Gespräch mit Herbert Konrad
Herr Konrad, Sie stammen direkt aus Tirschenreuth?
Ja, ich bin aus Tirschenreuth, genauer gesagt aus dem Stadtteil Matzersreuth. Ich wurde 1949 geboren, bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Nach der Schule habe ich Schlosser gelernt. Dann habe ich bei den Grenzschützern gedient, also beim Bundesgrenzschutz. Im Jahr 1976 bin ich zur Grenzpolizei in Mähring gekommen. Dort habe ich von den Heimattreffen der Vertriebenen aus dem Bezirk Plan-Weseritz erfahren. Das Treffen findet jedes Jahr Ende Juli statt und es haben immer sehr viele Vertriebene daran teilgenommen. Sie trafen sich in Mähring an der St.-Anna-Kirche. Ich habe mich damals gewundert, wie viele Menschen aus ganz Deutschland hierher kamen. Die kleine St.-Anna-Kirche steht auf einer Anhöhe bei Mähring. Daneben steht ein Aussichtsturm, von dem aus man ins Egerland sehen konnte. Man konnte Teile von Marienbad sehen, den Kaiserwald und ein Stück der Stadt Plan. Die Grenze war geschlossen, man konnte nur hinüberschauen. Die Leute haben sich hier ganz nah an der Grenze getroffen und mit Freunden aus der alten Heimat gesprochen.
War das für Sie als Bayer nicht seltsam – dreißig Jahre nach der Vertreibung? So lange lebten die Sudetendeutschen damals schon in Deutschland.
Ich habe hauptsächlich mitbekommen, was für ein einschneidendes Erlebnis die Vertreibung für diese Menschen gewesen ist. Sie haben ihren Besitz verloren, kamen in ein anderes Land. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich nichts dergleichen erlebt habe. Aber es war sicher schwierig, wieder eine neue
Existenz aufzubauen. Ich habe das in gewisser Weise bewundert, wie sich jedes Jahr mehrere tausend Menschen getroffen haben. Wie sie nach Hause geschaut haben. Wie sehr sie sich gewünscht haben, auch dorthin zu können.
Gibt es unter Ihren Verwandten jemanden, der die Vertreibung direkt miterlebt hat?
Nein, niemanden. Aber die Sudetendeutschen habe ich aus Tirschenreuth gekannt. Sie haben hier viele Firmen gegründet und waren sehr geschäftstüchtig. In meiner Jugend habe ich viele aktive Leute gekannt, die aus dem Sudetenland stammten. Sie waren fleißig und haben sich für die Zukunft interessiert.
Wenn Sie zu Hause verkündet hätten, dass Sie eine Sudetendeutsche heiraten wollten, was hätte man Ihnen gesagt?
Wenn jemand schon länger hier gelebt hat, dann war seine Herkunft nicht mehr wichtig. Entscheidend war, dass man sich menschlich verstand. Aber persönliche Erfahrungen mit einer Hochzeit mit einer Sudetendeutschen habe ich nicht.
Wie war die Arbeit als Grenzpolizist? Der Grenzübergang war bei Waidhaus (Rozvadov). Mir kommt es so vor, als hätten Sie eine verlassene Gegend bewacht. Der Eiserne Vorhang hat für Ruhe gesorgt.
Es war zum Teil tatsächlich ein ruhiger Arbeitsalltag. Wir haben einen bestimmten Grenzabschnitt beobachtet, die Bewegung der tschechischen Soldaten, nach 1968 auch die russischen. Unsere Aufgabe war es, darauf zu achten, dass von Bayern aus niemand über die Grenze geht und wenn jemand von der anderen Seite rüber kam, also von Osten nach Westen, dann hatten wir uns im polizeilichen Sinne darum zu kümmern.
Hat jemals jemand versucht, von Westen nach Osten zu gelangen?
Es soll mal jemand versucht haben, aber angeblich wurde er von den tschechischen Soldaten festgenommen.
Waren Sie jemals weiter auf der tschechischen Seite?
Ja, ein paar Mal pro Jahr wurde Holz transportiert. Firmen aus Deutschland haben sich mit tschechischen Firmen geeinigt, dass sie am geschlossenen Grenzübergang das Holz abholen. Dann durften wir die Grenzschranken öffnen. Die deutschen Lastwagen sind dann über die Grenze gefahren und haben das Holz aufgeladen.
Wie genau ist das abgelaufen? Sie haben von Schranken gesprochen – Sind Sie auch durch die Absperrungen des Eisernen Vorhangs gefahren?
An der Stelle, wo die Grenze verlief, war auf der tschechischen und deutschen Seite eine Schranke. Ungefähr einen halben Kilometer weiter waren Zäune und Absperrungen. Das Holz wurde direkt hinter dem Zaun aufgeladen. Also sind wir ein paar hundert Meter auf das tschechoslowakische Gebiet gekommen. Aufladen und sofort zurück. Wir haben die Ausweise der Deutschen kontrolliert, die Tschechen haben die tschechischen Bürger überprüft. Wir kannten uns schon, es waren immer die gleichen Fahrer, Waldarbeiter und Soldaten.
Haben die Tschechen irgendwie versucht mit Ihnen zu reden, wenn Sie sich schon gekannt haben? Oder Sie mit ihnen?
Das klingt alles wie ein Treffen von Giraffen und Dinosauriern, diese Leute mussten gründlich überprüft worden sein, wenn man sie über die Grenze gelassen hat. Persönlichen Kontakt gab es nur sehr wenig. Sie waren nicht begeistert, wenn wir versucht haben, sie anzusprechen, weder die Soldaten, noch die Waldarbeiter. Man hat sich gegrüßt, aber ohne Händeschütteln. Wir haben „Servus“ gesagt, und jeder hat seine Arbeit gemacht. Abends wurde die Schranke runtergelassen und die Grenze war…
… wieder ordnungsgemäß gesichert. Wie lang war Ihr Grenzabschnitt, wie sah für gewöhnlich Ihr Arbeitstag aus?
Unser Abschnitt reichte von Neualbenreuth fast bis Bärnau, bis Hermannsreuth. Das waren ungefähr 25 Kilometer. Wo es ging, sind wir mit dem Auto gefahren, unterwegs waren einige Beobachtungsposten. An einigen Stellen sind wir zu Fuß an der Grenze entlang gegangen um zu sehen, ob sich auf der anderen Seite Fahrzeuge bewegen. Oder ob auf unserer Seite nicht irgendwelche Spuren sind. Darüber hinaus haben wir normale Polizeiarbeit gemacht. Diebstähle, Verletzungen, normale Aufgaben der Polizei, zusätzlich zur Grenzbeobachtung.
Wie viele Grenzschützer waren an so einem 25 Kilometer langen Abschnitt im Einsatz?
In Mähring zunächst acht, das wurde später reduziert auf sechs. Die höchste Anzahl an Grenzschützern während meiner Dienstjahre war zwölf, dann wurden es allmählich weniger. Erst nach der Grenzöffnung 1990 wurden es wieder mehr.
Wer lebte in der Nähe der Grenze? Das war das Ende der Welt, dahinter Niemandsland. Hatte das nicht Einfluss auf die Psyche der Menschen, die dort lebten?
Es gab Leute, die unsere Gegend tatsächlich als das „Ende der Welt“ bezeichnet haben. Leute von außerhalb haben das so gesehen, aber die Einheimischen haben sich hier wohl gefühlt. Wer hier Arbeit fand, der war richtig froh, die Übrigen mussten ins Landesinnere fahren. Eine depressive Stimmung oder gar einen Kollaps hat man hier nicht wahrnehmen können, die Menschen haben die Ruhe genossen. Später sind immer mehr Leute hier her gekommen um Urlaub zu machen. Es hatte sich herumgesprochen, dass es hier so ruhig ist und wir wurden zum Erholungsgebiet. Kurz gesagt hat man hier vollwertig leben können.
Sind Sie Menschen begegnet, denen es gelungen ist, von Osten aus über die Grenze nach Westen zu gelangen?
Ich habe von einigen solcher Fälle gehört, dass jemand von der tschechischen Seite rüber gekommen ist. Meistens in der Nacht. Unsere Aufgabe war es, solche Menschen zur nächstgelegenen Polizeistation zu bringen. Details darüber, wer sie dann was gefragt hat, haben wir nicht erfahren. Und direkt darüber reden konnte man nicht, diese Menschen sprachen Tschechisch oder Russisch. Ich selbst habe aber keinen solchen Fall miterlebt.
Wie sind Sie als Polizist dazu gekommen, dass Sie sich heute um die Restaurierung der St.-Anna-Kirche in Plan bei Marienbad kümmern? Kommen Sie aus einem katholischen Elternhaus?
Ja, ich wurde katholisch erzogen, hier in Tirschenreuth war ich zur Erstkommunion, zur Firmung und auch meine Hochzeit fand hier statt. Wie ich schon erwähnt habe, dank meiner Arbeit als Grenzpolizist in Mähring habe ich die Verbundenheit der Vertriebenen kennen gelernt. Niemand konnte sich damals vorstellen, dass die Grenze einmal wieder geöffnet wird.
Dann kam das Jahr 1990, zwischendurch hatte ich an verschiedenen Orten gedient. Den 1. Mai 1990, als die Tschechen frei nach Deutschland durften und die Deutschen in die Tschechoslowakei, habe ich am Grenzübergang Schirnding erlebt. Ich habe die Gelegenheit der offenen Grenze auch ausgenutzt, wir haben uns aufs Fahrrad gesetzt und sind nach Tschechien gefahren. In Broumov/Braunau wurde gefeiert, dort waren Tschechen, Deutsche und Sudetendeutsche zusammen gekommen. Viele Leute waren zu Fuß unterwegs, es war eine tolle Atmosphäre.
Unser Pfarrer in Tischenreuth, Georg Maria Witt, sagte damals, dass wir von jetzt an die Wallfahrten zu St. Anna nicht nur an unserer kleinen Kirche in Mähring feiern werden, sondern wieder zum ursprünglichen Wallfahrtsort, der St.-Anna-Kirche in Plan, pilgern werden. Die Kirche in Mähring war ja nur deshalb entstanden, weil man nicht über die Grenze durfte. Aus Tirschenreuth sind damals zwölf Busse gefahren und tausend Leute gingen zu Fuß. Ich bin immer noch ergriffen, wenn ich daran zurückdenke. Die Kirche in Plan war einfach eingerichtet, aber es ist ein stattlicher Barockbau, und damals war sie 50 Jahre lang verlassen gewesen. Für mich war das ein lebendiges Zeichen dafür, dass es sich lohnen wird, die Kirche instandzusetzen. Unser Pfarrer arbeitete mit dem Architekten Klaus Peter Brückner zusammen, der die Renovierungsarbeiten plante. Nach sechs Jahren Arbeit, 1996, hat der damalige Tirschenreuther Bürgermeister, Ludwig Wolfrum, die aktive Leitung der Instandsetzung der Kirche aus Altersgründen aufgegeben. Man hat jemanden Neues gesucht und mich angesprochen. Ich habe spontan zugesagt. Gleich im Jahr 1996 habe ich einen Verein für die Instandsetzung der St.-Anna-Kirche gegründet. Ich bin zum Vorsitzenden des Vereins gewählt worden und bin es auch heute noch, der Verein hat insgesamt 75 Mitglieder auf tschechischer und deutscher Seite. Der jährliche Beitrag beträgt 15 Euro, für alle. Wir machen die praktischen Arbeiten – sammeln Spenden, schreiben Anträge, machen die Abrechnungen. Die Spenden können dank des Vereins von der Steuer abgesetzt werden.
Wir haben die notwendigsten Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Das Dach war in einem sehr schlechten Zustand, aber es hatte zum Glück noch nicht durchgeregnet. Wir haben die Grundmauern von außen und innen trocken gelegt. Die Türen und beschädigte Fenster haben wir restaurieren lassen. Zu guter Letzt haben wir die Fassade erneuert. Die finanziellen Mittel reichten nicht mehr für die Instandsetzung des Kirchturms, der irgendwann von einem
Blitz zerstört worden war. Wir haben Geld vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond bekommen, von der Ackermann-Gemeinde und von vielen anderen. Die letzte Aktion war die Instandsetzung der Orgel. Seitdem kommen tolle Organisten hierher um auf dieser seltenen Orgel zu spielen.
Warum machen Sie das alles? Glauben Sie, dass Sie so leichter in den Himmel kommen? Wie kann ich mir das vorstellen? Eine Kirche in einem anderen Land. Nebenan war das Kloster der Redemptoristen, das sich der Staat einverleibt und zum Krankenhaus umfunktioniert hat. Warum machen Sie das, denn diese Kirche ist ja nur durch Zufall nicht zerstört worden?
Wissen Sie, dass mir diese Frage noch niemals gestellt wurde? Da müsste ich mir zuerst mal eine Antwort überlegen, aber so spontan könnte ich sagen:
Erstens – ich gehe gerne in die Kirche. Zweitens – ich mag schöne Gotteshäuser. Drittens – ein Gotteshaus schon von Weitem zu sehen, ist immer ein gutes Zeichen, auch wenn es nur der Kirchturm ist, den man aus der Ferne sieht. Die Kirche wurde uns von den Menschen aus vergangenen Zeiten als Erbe hinterlassen. Als ich die St.-Anna-Kirche zum ersten Mal gesehen habe, ein Bauwerk aus dem Jahr 1726, war ich beeindruckt. Diese wunderschönen Fresken, die schon um die hundert Jahre nicht restauriert worden waren…
Man muss dazu sagen, dass diese Arbeit auch dank der guten Zusammenarbeit mit den Menschen auf der tschechischen Seite möglich ist. Aber einfach ausgedrückt: Der Stadtpfarrer hat mich gefragt, und ich habe spontan zugesagt, weil ich dachte, dass ich das schaffe.
Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? Angeblich haben hier Wunderheilungen stattgefunden, an der Heilquelle bei der Kirche. Heilungen von Blinden und Gelähmten.. Was würden Sie sich für ein Wunder wünschen?
Ein Wunder ist doch schon passiert. Tirschenreuth und Plan sind Partnerstädte geworden. Aus den Kontakten, die auf kirchlicher Ebene entstanden waren, erwuchsen Kontakte auf politischer Ebene.
Haben Sie einen Schlüssel zur St.Anna-Kirche?
Wir haben einen. Genauso wie der Pfarrer in Plan können wir interessierte Leute hineinlassen, die darum bitten.