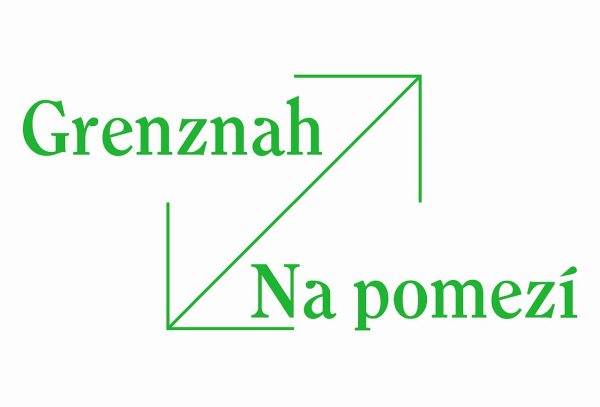Ehrenbürger der Stadt Asch wohnhaft in Tirschenreuth
Gespäch mit Horst Adler
Herr Adler, wir treffen uns hier in Ihrem schönen Haus in Tirschenreuth. Die erste Frage, die ich in Plan (Planá) stelle, wohin praktisch alle nach dem Krieg gegangen sind, lautet: „Wann sind Sie nach Plan gekommen?“ Sie wurden in Asch geboren. Daher bietet sich eine ähnliche Frage an: Warum sind Sie nach Tirschenreuth gekommen?
1946 sind wir aus der Tschechoslowakei ausgewiesen worden. Mit einem Güterzug, wie das üblich war. Leider sind wir aus Asch nicht direkt über Eger (Cheb) nach Bayern ausgereist. Irgendwo bei Franzensbad (Františkovy Lázně) wurde unser Zug in die sowjetische Zone umgeleitet. Wir sind dann ungefähr acht Wochen von einem Lager ins nächste geirrt. Mein Vater war schon in Tirschenreuth. Er hatte hier eine Stelle. Es ist ihm gelungen eine Erlaubnis zu bekommen, durch wir zu ihm ziehen konnten. Aus einem Lager unweit von Berlin.
Wie alt waren Sie damals?
Zwei. Ich erinnere mich an nichts. Aber ich habe vieles oft in Erzählungen gehört. Von den Eltern und den Großeltern. Ich kannte auch alle Gemeinden um Asch herum, die Straßennamen, die Namen der Nachbarn.
Die Großeltern wohnten auch in Tirschenreuth? Die Angehörigen deutschböhmischer Familien sind oft in verschiedenen Teilen Deutschlands gelandet.
Wir hatten großes Glück. Die Familie ist zusammengeblieben. Selbst beim Transport wurden wir nicht getrennt. Wir sind mit beiden Großelternpaaren, von mütterlicher und von väterlicher Seite nach Tirschenreuth gekommen. Und auch mit zwei Onkeln und zwei Tanten. In Tirschenreuth haben wir in einem sogenannten Flüchtlingslager eine Unterkunft bekommen. Als das Lager dann 1952 aufgelöst wurde, hat mein Vater dieses Haus gebaut. Ohne Geld, mit einfachen Mitteln, zu einem großen Teil aus eigener Arbeit. Seitdem wohne ich hier.
Ihr Vater ist direkt aus der Kriegsgefangenschaft nach Tirschenreuth gekommen?
Ja. Einmal ist er illegal über die Grenze gekommen und hat die Familie besucht, aber dann ist er hierher, nach Tirschenreuth, zurückgekehrt. Über einen Bekannten hat er eine Arbeit bekommen. Damals musste man einfach Beziehungen haben. Man kann also sagen, dass mein Vater direkt aus der Kriegsgefangenschaft nach Tirschenreuth gekommen ist.
Haben Sie die Erzählungen über den Verlust der Heimat als Belastung oder Schizophrenie empfunden? Viele junge Sudetendeutsche erzählen davon, dass ihnen die Angehörigen vom Paradies in Böhmen erzählt haben, während sie schon fest in Deutschland gelebt haben.
Ich habe das nicht als schizophrene Situation empfunden. Natürlich war die Heimat für meine Eltern und Großeltern das Paradies. Aber wir haben uns hier mit den Jahren so gut eingelebt, dass wir sagen können – das ist unsere zweite Heimat. Aber wenn mich jemand fragt „Wo bist du zu Hause?“, antworte ich „Meine Heimat ist Asch, aber ich lebe in Tirschenreuth.“
Ich habe hier mein ganzes Leben gelebt, ein schönes Leben.
Ich glaube, für Tschechen ist diese Art von Unterteilung schwer verständlich. Domov, auf Deutsch Heimat, hat im Tschechischen nicht so eine starke emotionale Komponente wie im Deutschen. Worin besteht der Unterschied zwischen Heimat und Wohnort?
Ich verstehe Heimat als etwas Tieferes als Wohnort. Mir geht es hier gut, aber Heimat bedeutet mehr für mich. Ich habe als Kind so viel über die Heimat gehört, dass ich Asch als meine wirkliche Heimat betrachte.
Goethe hat in seinem Tagebuch geschrieben, dass Asch die hässlichste Stadt im ganzen Christenland sei. Seit seiner Zeit hat sich das eher noch verschlechtert. Glauben Sie, dass Sie Glück hatten, wo Ihr Wohnort doch so viel schöner ist als Ihre Heimat?
Asch war, wie ich es aus Erzählungen kenne, eine Industriestadt. Schön war sie nicht gerade, aber es lebten hier viele reiche Leute, die hübsche Villen bauten. Den Begriff Umweltschutz gab es zu der Zeit noch nicht und so ging der ganze Qualm direkt in die Luft und die Abwässer aus den Färbereien flossen in die Bäche. Nach dem Krieg war Asch wie kaum eine andere Stadt in Böhmen zerstört worden. Ganze Straßenzüge sind in die Luft gesprengt worden, den Marktplatz gibt es nicht mehr, ein Teil der Fabriken ist zusammengestürzt. Wenn ich mit älteren Leuten nach Asch gefahren bin, die dort gewohnt hatten, ist es schon vorgekommen, dass sie die Orientierung verloren haben. Sie haben die Stadt einfach nicht wiedererkannt. In den sechziger und siebziger Jahren war es eine Ruinenstadt. Heute sind die Ruinen bereits abgetragen worden, an den Stellen wächst nun Gras oder es ist ein Park entstanden. Nur durch alte Fotos kann man noch feststellen, wo eine Straße entlanggeführt hat oder wo der Friedhof war. Die Stadtverwaltung hat in den letzten Jahren wirklich viel dafür getan, dass die Stadt wieder schön aussieht. Ich bin froh, dass die Denkmäler, die nicht völlig zerstört worden sind, jetzt nach originalen Vorlagen restauriert werden. Den Vorkriegszustand wiederherzustellen ist nicht möglich, aber vieles hat sich in den letzten Jahren verbessert.
Sie haben aber hier gelebt. Im Lager haben Sie von Beginn an bis in die fünfziger Jahre unter den gleichen Bedingungen gelebt?
Die Zeit im Lager war für meine Eltern und Großeltern schwer. Für uns Kinder war es nicht so schlimm. Wir haben die Not nicht so schwer empfunden, weil die anderen um uns auch nichts hatten. Ähnlich wie die heutigen Asylsuchenden haben wir in Gemeinschaftsunterkünften gelebt. In der ehemaligen Fabrik hatte jede Familie zwei Doppelstockbetten. Um sie herum wurden Decken gespannt. Das war die sogenannte Privatsphäre. Auf die Gemeinschaftstoilette ging man durch einen langen Korridor. Zu meinen ersten Kindheitserinnerungen gehört ein riesiger Raum, in dem sich Leute Seite an Seite waschen mussten. Ein Wasserhahn neben dem anderen, ein Stückchen weiter wäscht sich wieder jemand anders. Unsere Familie hat aber ungefähr nach einem Jahr eine eigene Wohnung bekommen. Zwei Zimmer, das ehemalige Werksbüro. Wir waren fünf Personen in diesen zwei Zimmern. Mein Großvater wurde dann Hausmeister im Lager, deswegen haben wir eine bessere Unterkunft bekommen. Im Laufe der nächsten Jahre haben auch andere Leute kleine Wohnungen bekommen. Zwei Zimmer mit Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftstoiletten. Die Unterbringung im Gemeinschaftssaal war dann nur noch für diejenigen gedacht, die lediglich für eine begrenzte Zeit geblieben sind. Für die, die weiterziehen wollten.
Dann sind Sie also noch zu der Zeit, in der Sie im Lager gewohnt haben, in die Schule gekommen? Ja, das war 1951. Die Schule war am anderen Ende der Stadt, deswegen sind wir jeden Tag zu Fuß hinund zurückgelaufen. Das Lager wurde, wie ich schon erwähnt hatte, 1952 aufgelöst, weil damals in Tirschenreuth Wohnungen gebaut wurden. Es entstanden Wohnhausblöcke, die bis heute stehen. Mein Vater hat damals erreicht, dass alle Verwandten ihr Geld zusammenlegten und gemeinsam dieses Haus bauten. Fünf Familien haben hier gewohnt. Meine Eltern, beide Großelternpaare, zwei Onkels und zwei Tanten. Zwei Zimmer pro Familie. Zum Waschen sind wir in den Keller gegangen. Unsere Familie hatte drei Zimmer, ich hatte ein ganz kleines, aber eigenes Zimmer bekommen. Ich war das einzige Kind in der Familie.
Hat Ihre Mutter gearbeitet? Und was genau hat Ihr Vater gemacht? Meine Mutter hatte keinen Arbeitsplatz. Sie hat sich um den Haushalt gekümmert. Mein Vater hatte eine Stelle als Fahrer für die Landkreisverwaltung bekommen, genauer gesagt auf dem Flüchtlingsamt, das ein Teil davon war. Er war stolz darauf, dass er noch in Tschechien den Führerschein in verschiedenen Klassen gemacht hatte. Manchmal ist er sogar in Prag gefahren. Das hat ihm nach dem Krieg geholfen.
Haben Sie in der Schule gespürt, dass Sie aus einer sogenannten Flüchtlingsfamilie kommen?
Selbstverständlich haben wir das gespürt, und zwar sehr. Man hat uns als Flüchtlingskinder bezeichnet, was wir nicht waren, wir waren Vertriebene. Als Kinder sind wir oft die Zielscheibe für Beschimpfungen gewesen. Das Wort
„Böhm“, also „Čech“, hat man als Schimpfwort benutzt. „Bist auch ein Böhm“ haben wir oft gehört im lokalen Dialekt, der dem sehr ähnlich ist, wie wir in Asch gesprochen haben. Es war nicht schwer uns zu erkennen, weil wir ärmer waren als die Kinder von hier. Meine Eltern haben es auch sehr zu spüren bekommen, dass wir Vertriebene waren. Auf verschiedene Art und Weise wurden sie die ganzen Jahre daran erinnern. Als wir das Haus gebaut haben, hat das großen Neid bei den Einheimischen geweckt. Sie haben gesagt, dass wir mit leeren Händen gekommen sind und nun schon ein Haus bauen. Wie ist das möglich? Über die Jahre ist das besser geworden, heute ist überhaupt keine Abneigung mehr zu spüren.
Wie lange haben Ihre Eltern und Großeltern gehofft, dass sie nach Böhmen zurückkehren werden? Ich würde sagen, nicht so lange. Sie haben irgendwann in den fünfziger Jahren aufgehört zu hoffen. Mein Vater hat zu Beginn in Erwägung gezogen, dass wir nach Amerika auswandern. Wir hatten dort – und haben noch immer – viele Verwandte. Mein Vater hat sich damals ein englisches Wörterbuch gekauft, das wir heute noch haben. Er hat Englisch gelernt. Dieses Vorhaben hat sich nicht verwirklicht, weil ich als Kind getrennt von den anderen hätte reisen müssen, warum weiß ich nicht mehr. Meine Mutter hat gesagt, dass sie mich nicht aus den Händen gibt.
Also sind Sie daran schuld…
Ja, ich bin daran schuld, dass wir heute keine Amerikaner sind.
Wollten Sie innerhalb Deutschlands nicht irgendwo anders hin gehen? Nach dem Krieg war das hier schließlich nur ein armer Landkreis – im Gegensatz zu heute.
Vielleicht besteht der Hauptgrund dafür, dass wir geblieben sind, darin, dass uns die Leute von hier uns sehr ähnlich waren. Luftlinie sind es von hier nach Asch fünfzig Kilometer. Die Leute hier denken auf die gleiche Weise und der Dialekt war, wie ich schon sagte, fast identisch. Von unseren Nachbarn aus Asch haben sich einige bei Stuttgart niedergelassen und andere in Hessen. Mein Vater hat hier aber eine relativ sichere Anstellung gefunden. Das war auch mit entscheidend, dass wir uns hier eingelebt hatten. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Oma durch die nahen Dörfer „hamstern“ gegangen bin. Meine Oma tauschte Sachen gegen Lebensmittel. Wir sind immer ungefähr acht Kilometer gelaufen und wir sind nie mit leeren Händen zurückgekommen. Meiner Oma gelang es immer Dinge zu tauschen.
Auf die Oberschule sind Sie auch hier gegangen?
Ja. Es hat gerade gut gepasst, dass in Tirschenreuth ein Gymnasium gebaut worden ist. Ich konnte von der Grundschule, aus der fünften Klasse, direkt ans Gymnasium gehen. Dann habe ich in der Armee gedient und in Erlangen studiert. Aber ich bin zurückgekommen. Ich habe angefangen, an der Schule zu unterrichten, an der ich selbst Schüler war und bin mein ganzes Berufsleben hiergeblieben.
Wie hat sich die Stadt während ihres Lebens verändert?
Zu Beginn gab es hier Industrie, zum Beispiel Porzellan, Sudetendeutsche haben hier Firmen gegründet, heute ist Tirschenreuth mit dem erneuerten Stadtteich in der Mitte eine ruhige und wohlhabende Stadt.
Wie haben Sie die Veränderungen der Stadt wahrgenommen, in der Sie so viele Jahrzehnte verbracht haben?
Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Tirschenreuth jemals eine Industriestadt war. Es gab hier zwar eine Porzellanfabrik und einen Keramikbetrieb. Durch diese Betriebe hatten die Leute Arbeit, aber eine Industriestadt sieht anders aus. Die größte Veränderung für Tirschenreuth war der Zuzug unsererseits. Die Stadt hatte 1946 fünfeinhalbtausend Einwohner und zweieinhalbtausend Vertriebene kamen hierher und ließen sich nieder. Die Vertriebenen haben das Leben in Tirschenreuth von Grund auf verändert. Nicht nur in Bezug auf die Anzahl, sondern auch durch die Berufe, die die Zugezogenen ausübten. Es entstanden sechzig Firmen und Geschäfte, die Vertriebene gegründet wurden. So kam es zu einer großen Veränderung Tirschenreuths. Ich glaube auch im kulturellen Sinn. 1948 haben die Vertriebenen hier einen Kulturverein gegründet. Mit Theateraufführungen, Vorträgen, Musikveranstaltungen. Das gab es vorher nicht. Ich glaube, dass die Stadt durch den Zuzug von Vertriebenen viel gewonnen hat. Selbstverständlich auch die Schulen. Eine höhere Schule hat in einem Ort immer etwas bedeutet, sie bietet jungen Menschen die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln. Man musste wegen der Ausbildung nicht mehr wie vorher nach Weiden oder Marktredwitz fahren. Und im Internat wohnen. Das ist doch ein Fortschritt.
Welche Fächer haben Sie unterrichtet?
Chemie und Sport. Das war damals eine ungewöhnliche Kombination, hat aber meinen Interessen entsprochen.
Was haben Sie in Ihrer Freizeit gemacht? Waren Sie Mitglied im Vertriebenenverein? In der Sudetendeutschen Landsmannschaft? Wie hat sich ihre ursprüngliche Heimat das beeinflusst, was sie damals gemacht haben?
Als junger Mensch habe ich mich nicht in solchen Vereinen engagiert, die einen Bezug zu meiner ursprünglichen Heimat hatten. Im Gegensatz zu meinem Vater. Mein Vater war immer Funktionär der Sudetendeutschen Landsmannschaft, er hatte den Vorsitz der Tirschenreuther Organisation inne. Erst als ich ungefährvierzig, fünfzig wurde und mein Vater seine aktive Zeit beendete, begann ich mich zu engagieren. Ich wollte in die Fußstapfen meines Vaters treten. Weil bei uns so viel über die Heimat gesprochen wurde, musste ich in diesem Sinne weitermachen. Vorher habe ich meine Zeit, um es kurz zu sagen, mit Sport verbracht. Dann bin ich in die Sudentendeutsche Landsmannschaft eingetreten und bin auch für eine Funktion gewählt worden. Ich engagiere mich auch im Heimatverband des Kreises Asch, in dem die Vertriebenen aus dem ehemaligen Bezirk Asch organisiert sind.
Wann waren Sie das erste Mal wieder in Böhmen?Irgendwann Ende der siebziger Jahre. Ich kann mich daran erinnern, wie ängstlich wir waren. Meine Eltern hatten Angst an der Grenze. Wir wurden sehr gründlich kontrolliert, oder genauer gesagt schikaniert. Mein Vater war Funktionär in der Landsmannschaft, darum hat er befürchtet, dass die Tschechen ihn deswegen verhaften könnten. Aber alles ist gut gegangen nach der üblichen zweibis dreistündigen Prozedur an der Grenze. Die erste Fahrt nach Hause war für uns furchtbar enttäuschend. Unser Haus war verfallen und mit ihm das ganze Dorf, in dem wir gelebt hatten. Der Verfall unseres Hauses hat meine Eltern und Großeltern mit großer Traurigkeit erfüllt. Aller zwei Jahre sind wir nach Hause gefahren und damals mussten wir ein Visum beantragen, wir waren verpflichtet Geld zu tauschen usw.
Und was haben Sie gemacht? Haben Sie sich angeschaut, wie Ihr Haus verfiel und sind dann zurückgefahren? Dafür braucht man nicht mehr als ein paar Minuten. Was haben Sie in der restlichen Zeit gemacht, im realen Sozialismus, zum Ende der Tschechoslowakei hin? Sind Sie wenigstens nach Karlsbad (Karlovy Vary) gefahren, wo es auch damals wenigstens ein bisschen nach etwas ausgesehen hat? Haben Sie die Vorteile als reiche Deutsche überhaupt nicht ausgenutzt?
Nein, wir sind nur zu Erinnerungsorten von meinen Eltern gefahren. Durch die Straßen in Asch, eine nach der anderen, durch Nachbardörfer. Es hat überall gleich ausgesehen. Einstürzende Häuser, alles lag in Trümmern. Überall. Woandershin zu fahren wurde nicht in Erwägung gezogen. Mit meinem Vater bin ich dann einmal nach Prag (Praha) gefahren und nach Prelauc (Pĭelouč), weil er dort in der tschechoslowakischen Armee gedient hat.
Also haben Sie eine Depression bekommen und sind dann zurückgefahren? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Alle zwei Jahre dorthin fahren, um sich davon zu überzeugen, dass mein Haus einfällt, bis es zusammenstürzt. Warum sind Sie nicht nach Mallorca geflogen? Wie so viele Deutsche damals?
Ja, so war das, das ist schon merkwürdig. Von einem Besuch zum nächsten haben wir beobachtet, wie der Verfall vorangeschritten ist. Bis unser Haus verschwand. Zuerst haben die Fenster gefehlt, dann die Türen, dann ist es verschwunden. Trotzdem sind wir immer wieder dorthin gefahren.
Für wie lange? Erinnern sie sich an die hässlichen, sozialistischen Hotels?
Wir haben dort nie übernachtet. Es ist nicht weit von Tirschenreuth, wir sind immer morgens losgefahren und abends zurückgekommen.
Sie waren im sportlichen Bereich aktiv. Auch in der Politik, in Tirschenreuth?
Nein, ich bin ein unpolitischer Mensch.
Aber sind Sie heute innerhalb Tirschenreuths nicht ein Fachmann der Stadt für die Integration von Vertriebenen?
Die Bezeichnung „Fachmann“ ist übertrieben. Aber ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Ich schreibe ein Kapitel über die Vertriebenen und die Flüchtlinge für die Stadtchronik von Tirschenreuth. Ab 1946 bis heute.
Haben Sie sich mit Leuten getroffen, die Sie nicht kannten? Die Sie nicht aus dem Nachkriegslager in der Fabrik kannten? Vom Bett nebenan, die Sie fünfzig Jahre nicht gesehen haben? Wie war das, in die Vergangenheit zurückzukehren?
Mich interessieren menschliche Schicksale. Man kennt sich, bei uns in Tirschenreuth. Ich habe mit einigen Vertriebenen gesprochen, die das Gleiche erlebt haben wie ich. Ich habe ihre Erlebnisse aufgezeichnet. Ich war ergriffen von ihren Erzählungen. Alle könnten einen Roman darüber schreiben. Größtenteils voller Schicksalswendungen, manchmal auch mit lustigen Episoden.
Und wenn Sie alle Schicksale zusammenfassen würden? Ist es eine Erfolgsgeschichte? In Tirschenreuth? Mit leeren Händen gekommen und Erfolg gehabt?
Ich glaube, dass die Geschichte der Vertriebenen in Tirschenreuth eine Erfolgsgeschichte ist. Bis heute gibt es viele Betriebe, denen es gut geht und die von Vertriebenen gegründet worden waren. Tirschenreuth hat in jeder Hinsicht durch den Verdienst der Vertriebenen viel gewonnen, wie ich schon sagte. Natürlich hat sich in dieser Zeit die wirtschaftliche Situation in Deutschland stark verbessert – die Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders.
Können Sie sagen, welche der Geschichten, die sie zusammengesammelt haben, Sie besonders bewegt hat?
Bei absolut allen geht es darum, sich mit dem Verlust der Heimat abzufinden. Bei den meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist es so ausgegangen, dass sie bei der Vertreibung niemanden von ihren Verwandten verloren haben. Bis auf ein Schicksal. Ich habe mit jemandem gesprochen, der aus Saaz (Žatec) kommt und als sehr junger, als Fünfzehnjähriger das Massaker in Postelberg (Postoloprty) erlebt hat. Er hat seine Haare und viel an Gewicht verloren, seine Mutter hat ihn praktisch nicht mehr erkannt, so abgemagert und grün und blau geschlagen wie er war. Das ist eine Geschichte, die mich bewegt hat. Um von etwas Fröhlicherem zu sprechen: Alle, die wir uns im Lager kennengelernt haben, erinnern sich daran, dass wir als Kinder nie alleine waren. Wir waren immer zwanzig, fünfundzwanzig auf einem Haufen, was bedeutete, dass wir jeden Tag etwas erlebt haben. Ich gehöre zu einer glücklichen Generation. In meinem Leben hat sich immer alles zum Besseren gewandelt. Wir haben bei Null angefangen und haben uns immer weiterentwickelt, vom Besitz her, der Bildung, der Erlebnisse, überall. Ich gehöre zu einer glücklichen Generation, weil ich den Krieg nicht erlebt habe. Die Kubakrise und ‘68, das waren kristische Momente, aber sie sind nicht in einen Krieg ausgeartet.
Asch war eine sehr evangelische Stadt. Waren Sie hier nicht auch vom Glauben her fremd?
Waren wir. Die evangelische Gemeinde hier in Tirschenreuth war vor unserer Ankunft nicht sehr groß. Auch das hat sich durch den Zuzug der Vertriebenen geändert. Für mich war das selbstverständlich wieder ein weiteres Stigma. Vertriebener und noch dazu Protestant.
Haben Sie eine Bayerin oder eine evangelische Vertriebene geheiratet?
Ich habe ein Mädchen von hier geheiratet. Katholikin.
Haben sich Ihre Eltern darüber geärgert?
Für meine Eltern war das kein Problem, aber für meine Schwiegereltern. Man kann nicht sagen, dass sie sich geärgert hätten. Aber sie waren sich unsicher. Aus zwei Gründen. Ich war ein eingewanderter „Böhm“ und Protestant. Das war besonders für meinen Schwiegervater ein Problem. Er hat mir ernste Briefe geschrieben, damit ich mir das Heiraten gründlich überlege. Er war nicht sicher, ob das alles bei so großen Unterschieden gut gehen kann.
Haben Sie in einer evangelischen oder in einer katholischen Kirche geheiratet?
Wir mussten in einer katholischen Kirche heiraten, sonst wäre meine Frau von ihrer Kirche exkommuniziert worden. Wir wollten damals eine ökumenische Trauung. Das hat der evangelische Pfarrer aber abgelehnt. Uns hat ein katholischer Pfarrer getraut. Ich musste unterschreiben, dass eventuelle Kinder katholisch erzogen werden würden. Ich habe gesagt, dass ich die Kinder vor allem christlich erziehen möchte. Mir wurde dann gesagt, dass man Kinder nur entweder so oder so erziehen könne.
Und wie ist das ausgegangen?
Die Tochter haben wir in der katholischen Kirche taufen lassen, sie wurde christlich erzogen. Sie ist aber vor einiger Zeit aus der Kirche ausgetreten.
Gibt es einige sichtbare Spuren von den Vertriebenen in Tirschenreuth?
Eine ganze Menge. Zum Beispiel die Straße „Siedlerweg“ mit den kleinen Häusern, die die Vertriebenen nach dem Krieg gebaut haben. Sie ist gegenüber vom Stadtbad zu finden. Ein Freund von mir hat ein Buch über diese Straße geschrieben. Das Buch handelt davon, wie die Leute sich wünschten, wieder etwas Eigenes zu haben. Ein eigenes Haus, wenn auch ein kleines. Gebaut, genau wie unser Haus, mit den einfachsten Mitteln.
Auf dem Friedhof kann man einen Gedenkstein finden, der den Toten in der Heimat gewidmet ist. Für viele Leute war es traumatisch, dass sie nicht die Gräber ihrer Nächsten besuchen konnten. Sie hatten keinen Ort für ihre Trauer. Deswegen entstanden solche Gedenksteine. Die Friedhöfe zuhause verfielen oder wurden aufgelöst. Unser Friedhof in Asch wurde völlig vernichtet, einige Teile sind nun sogar Tennisplätze. Wir arbeiten momentan daran, dass die Fläche würdevoll aufbereitet wird. Die Grabmäler sind unwiederbringlich fort, genau wie die Gebäude, aber es entsteht wenigstens eine würdevolle Fläche zum Gedenken an die, die dort begraben sind.
Ich forsche in Tirschenreuth auch in alten Zeitungen und gehe die Besprechungen des Stadtrats in der Nachkriegszeit durch. Die Not, die nach dem Krieg herrschte, sticht dabei hervor. Die Masse der Ankommenden verursachte fast unlösbare Probleme bei der Versorgung mit Lebensmitteln, Kleidung, Wohnraum, Brennmaterial und ärztlicher Hilfe. Der Bürgermeister hat geschrieben – „weiterer Zuzug von Menschen ist nicht möglich“. Die Infrastruktur war überlastet. Wenn heute Flüchtlinge kommen, bringt das auch Probleme mit sich, aber die sind mit den damaligen nicht vergleichbar.
Auf was sind Sie stolz in Tirschenreuth, jetzt ohne Berücksichtigung des Flüchtlingsthemas?
Ich glaube, dass unser Marktplatz zu den schönsten in Bayern zählt. Den erneuerten Stadtteich, praktisch direkt in der Stadtmitte, kenne ich noch als eine mit Abfall verwahrloste Fläche. Heute kommen Touristen hierher und die Einheimischen haben hier eine Promenade. Die Umgebung ist schön mit der unberührten Natur. Innerhalb von fünf Minuten bin ich mit dem Rad in der Natur. Man kann stundenlang um die Teiche fahren. In der Nähe von München oder Nürnberg fährt man eine Stunde und man kommt an einem vollen Parkplatz raus. Das gibt es bei uns nicht.
Fahren Sie ab und an nach Böhmen, jetzt, wo das ohne Visum und Schikanen an der Grenze geht?
Ja, ich bin oft in Asch. Seit vielen Jahren habe ich guten Kontakt zu den Bürgermeistern, wir haben eine Reihe von Projekten im Museum und anderswo durchgeführt. Ich bin stolz darauf, dass ich zum Ehrenbürger der Stadt Asch ernannt wurde.