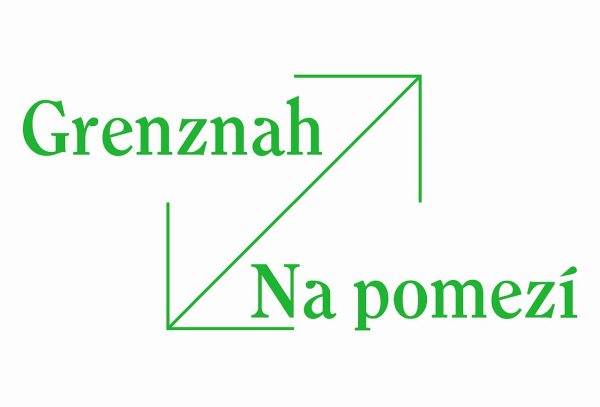Damals in Tirschenreuth
Gespräch mit Eberhard Polland
Herr Polland, Sie sind ein gebürtiger Tirschenreuther?
Ja, gebürtiger, seit 1948. Nachkriegsware.
Haben Sie Ihre Kindheit in diesem Hause verbracht?
Nein, dieses Haus hat meine Mutter im Jahre 1962 gebaut. Vorher wohnten wir in einer kleinen Wohnung. Mein Vater war Kriegsbeschädigter, hatte einen Bauchschuss. Er stammte aus Königsberg an der Eger (Kynšperk nad Ohĭí). Zu Hause hatten sie eine kleine Landwirtschaft. Mein Großvater war als Bierbrauer in der hiesigen Brauerei angestellt. Immer wenn ich dort bin und Bier trinke, sag ich mir, dass das ein Rezept meines Großvaters ist.
Der Vater wurde fünfmal operiert und im Jahre 1959 ist er an späteren Folgen der Kriegsverwundung gestorben. Der Großvater väterlicherseits arbeitete damals in der Brauerei Thurn und Taxis in Regensburg. Nach Vaters Tod zog er zu uns nach Tirschenreuth. Als mein Vater noch krank war, lebten wir wirklich in Not und Elend. Meine Mutter stammte aus Tirschenreuth, arbeitete im Missionshaus des St. Peter, wo man 1942 ein Notkrankenhaus errichtet hat, ein Kriegslazarett, und zwar in einem Büro. Dort wurde mein schwer verletzter Vater gebracht, und so haben sie sich auch kennengelernt.
Wie ist es Ihrer Mutter, einer Witwe, gelungen, ein Haus zu bauen?
Eine gute Basis für den Bau war nach meinem Erachten der sogenannte Lastenausgleich, was eine gewisse Entschädigung für das Eigentum war, das die Leute in der alten Heimat gehabt haben, im Falle meines Vaters und Großvaters im ehemaligen Sudetenland. Ich glaube, dass die Summe zweckgebunden war, man sollte sie für den Neubau benutzen. In unserem Fall machte die Entschädigung meiner Meinung nach rund um zwanzigtausend Mark. Auch der Großvater hat in Regensburg als Bierbrauer gut verdient. Sonst konnten sie es sich nicht erlauben.
Haben Sie studiert?
Nein. Nach acht Klassen Grundschule fing ich im Jahre 1962 im Büro der Tirschenreuther Molkerei als Lehrling an und wurde später Industriekaufmann. Nach sieben Jahren in der Molkerei öffnete meine Mutter gleich neben unserem Haus einen Lebensmittelladen. Bei ihr arbeitete ich weitere sieben Jahre. Dann wurde ich am Landratsamt angestellt und blieb dort bis zu meiner Rente. Fünfzehn Jahre kümmerte ich mich um die Krankenhäuser, um die Rechnungen der Patienten. Weitere fünfzehn Jahre befasste ich mich mit der Wasserversorgung. Insgesamt verweilte ich im Amt einunddreißig Jahre.
Wie kamen Sie zur Topographie und der lokalen Geschichte? Zur Heimatpflege, wie man es in Bayern nennt?
Mein Interesse kam zu mir wie ein Bazillus. Ich wurde angesteckt und die Ansteckung hat mich nicht mehr verlassen. Im Jahre 1972 habe ich einen Reporter kennengelernt, der alte Fotos aus Tirschenreuth gesammelt hat. Ich fing an, Besucher unseres Ladens auszufragen, ob sie vielleicht einige alte Fotos hätten. Vor vierzig, fünfzig Jahren konnte man einerseits solche Frage stellen, andererseits konnte man problemlos einige Fotos wirklich erhalten. Ich sammele immer noch alte Fotos aus Tirschenreuth. Heute werden sie von mir gescannt und zurück in die Familien gegeben. Seit acht Jahren bin ich offiziell der Stadtheimatpfleger. Ich habe schon vier Bücher über unsere Stadt veröffentlicht, immer mit vielen Fotos und Dokumenten. Erster Teil behandelte Gefallene im Zweiten Weltkrieg. Nirgends gab es Angaben darüber. Das Buch heißt „Vergesst uns nicht“. Für das kleine Tirschenreuth zählte ich über vier hundert Gefallenen. Damals hatte es fünftausend Einwohner. Wenn man die Frauen, kleine Kinder und alte Leute abrechnet, ist es eine schreckliche Nummer.
Außer der Funktion des Stadtheimatpflegers wirken Sie auch im Verein, der sich mit der örtlichen Geschichte befasst…
Ja, in diesen Verein mit dem offiziellen Namen Historischer Arbeitskreis trat ich im Jahre 1972 ein. Zu der Zeit gab es ihn etwa ein Jahr, gegründet vom Gymnasialdirektor Max Gleißner. Damals sagte ich, dass er wie ein Jesus wirkt, und wir folgen ihm wie die Apostel. Am Anfang richteten wir die alten Kreuze, die in Feldern standen, her und strichen sie an. Wir sammelten die Leichenbretter und weitere typischen alten Dinge, alle drei Monate gab es Vorträge, wir kümmerten uns um die örtlichen Künstler und halfen ihnen mit ihren Ausstellungen im Rathaus. Zehn Jahre nach dem Tod des Gründers wurde ich zum Vereinsvorsitzender gewählt. Die Stadt hat uns immer geholfen, vor allem der Erste Bürgermeister Franz Stahl. Wir haben ein kleines Gebäude bekommen und nannten es Max Gleißner Haus. In ihm werden heute Vorträge abgehalten. Im Rahmen des Vereins haben wir auch Museen und Ausstellungen in anderen Städten besucht.
In ihrem Verein begann auch die Arbeit am Fischereimuseum?
Mit der Arbeit am zukünftigen Museum begannen wir im Jahre 1978, zuerst zu zweit. Wir sind die Bauern abgefahren und fragten, ob sie noch Dinge hätten, die mit der Fischerei zusammenhingen, alte Bottiche, Netze, Kescher. Wir bekamen Rüttelfässer, die auf den Transportfahrzeugen schaukeln, damit Luft ins Wasser käme und die Fische nicht erstickten. Oder das Gerät, das man benutzt, wenn man den Teich ablässt – eine Art Pipe mit anknüpfenden hölzernen Trögen. Die Bauer haben uns die Sachen großzügig geschenkt, denn sie brauchten sie zur Arbeit nicht mehr. Restauriert haben wir sie alleine. Wie man es macht, haben uns die Leute aus dem Museum in Waldsassen erklärt. Im hiesigen Kloster hatten 1975 gerade die letzten Ordensschwestern Schluss gemacht. Wir haben im Rathaus gefragt, ob wir dort einige Räumlichkeiten benutzen könnten. Da gab es Zweifel: „Wer würde hierherkommen, um sich das alte Gerümpel anzuschauen?“ Aber wir haben die Räumlichkeiten schließlich ohne Erlaubnis besetzt und aufgeräumt, einige kleine Räume, wo die Schwestern gelebt haben, gestrichen, und einen Raum nach dem anderen mit alten Fischergeräten eingerichtet. Einer von uns, der damals auch mitgemacht hat, mein Schulfreund Franz Kühn, war zu der Zeit Stadtrat und Inhaber des Restaurants Zum Schwan auf dem Marktplatz. Einmal hämmerte er einen langen Nagel ein, worauf etwas hängen sollte. Der Nagel ging aber durch und ragte dann im Nebenzimmer ein paar Zentimeter aus der Wand heraus. So benutzten wir einen Nagel zweimal und ließen auch auf der anderen Seite etwas hängen.
Das Ganze war sehr schlicht und einfach. Aber es hatte seinen Charme und entsprach unserem Geschmack. Der Hauptkonservator aus Regensburg mochte uns irgendwie und hat uns Tipps gegeben. Wir wussten, dass wir eine Fachkraft bräuchten, die sich in musealen Dingen auskennt, aber dazu müsste man Geld haben. Und so ist es auch später passiert, Herr Dr. Josef Paukner nahm sich des Museums als Fachmann an und gestaltete es um. Die Leute sagen heute noch: „Das altes Museum war auch schön!“
Ich möchte gern zu Ihrer Funktion des Stadtheimatpflegers zurück. Was tun Sie alles?
Falls Leute etwas aus der Geschichte wissen wollen, fragen sie mich. Ein Heimatpfleger erklärt zum Beispiel den Leuten, die alte Sachen geerbt haben, welches Museum Interesse haben könnte.
Haben Sie irgendwo ein Büro?
Ach wo, das brauche ich nicht. Ich habe eine unbezahlte Funktion und wurde vom Bürgermeister und von dem Stadtrat ernannt. Ich gebe meine Kenntnisse weiter und beschäftige mich 40 Jahre mit der Stadtgeschichte. Jährlich veröffentliche ich etwa fünfzehn Aufsätze. Leute kennen mich, sie wenden sich an mich, auch die Stadt selbst. Alles entstand aus einer Frage des Bürgermeisters Stahl, ob ich nicht die Funktion eines Stadtheimatpflegers übernehmen möchte. Ich habe geantwortet: „Ja, falls ich helfen kann, tue ich es gerne.“
Haben Sie sich etwas vorgenommen, als Sie Ihre Funktion angetreten haben?
Das erste Buch habe ich vor zehn Jahren veröffentlicht, also noch vor meiner Ernennung. Jetzt bin ich beim vierten Teil. Es ist nicht das Ergebnis eines Vorsatzes, sondern einer systematischen Arbeit. Meine Buchreihe heißt „Damals in Tirschenreuth“. Mich interessiert zum Beispiel, wie hier der Bahnhof zustande kam oder wie sich das hiesige Sägewerk, die Porzellanoder Textilfabrik entwickelt haben. Oder die Fabrik für Motorwalzen. Die erste wurde bei uns im Jahre 1911 hergestellt. Eine längere Zeit beschäftigte ich mich mit der Geschichte des Krankenhauses in Tirschenreuth, das nächstes Jahr zweihundert Jahre seiner Existenz feiert. Ich sammele immer Fotos und Informationen, aber es ist nicht so, dass in einem Buch nur ein Thema vorkommt. Jetzt zum Beispiel schrieb ich über die letzte Hinrichtung mit dem Schwert im Jahre 1844. Es tauchen ständig neue Informationen, Dokumente, Zusammenhänge auf. Meine neueste Idee: Ich weiß nicht, wie lange ich hierbleibe, aber solange ich hier bin, brauche ich Beschäftigung – also schreibe ich etwas über das Sterben, über die Begräbnisse. Die Bestattungszeremonien sind ein sehr interessantes Thema. Ich habe nie geglaubt, wie große Unterschiede es beim Sterben gab. Warst du reich, bekamst du drei Pfarrer als Begleitung und die Zeremonie in der Kirche war groß. Mit den armen ging der Pfarrer nur ein Stück des Weges.
Die Leute mögen meine Bücher, weil jeder etwas darin für sich finden kann. Ich mache alles selbst, den Satz und die Graphik, bin mein eigener Verleger. In den Druck schicke ich immer das fertige Buch. Und ich bin froh, dass sich meine Bücher gut verkaufen.
Sie beschäftigen sich also vierzig Jahre mit ihrer Stadt. Was hat sich hier in all den Jahren geändert?
Tirschenreuth war früher ein landwirtschaftliches Städtchen. Auf dem Marktplatz wohnten die Händler, in den Straßen darunter die Handwerker und ganz unten am Graben, wie man überall sagte, hausten die Häusler und Tagelöhner. So hat die Stadt über Jahrhunderte funktioniert. Karpfen wurden hier seit 1180, seit der Gründung des ersten Stadtteichs, gezüchtet. Die ersten Teiche haben Fachleute aus Böhmen für die Zisterzienser gebaut. Schon damals konnte man Karpfen gut verkaufen. Seit 1218 gehörten wir zum Zisterzienserkloster in Waldsassen. Der damaliger Abt Hermann erkannte das wirtschaftliche Potenzial und ließ einen zweiten großen Teich bauen. Aus Tirschenreuth wurde de facto eine Inselstadt. Zu Weihnachten bekamen hier die Bürger Karpfen geschenkt. Als es in den alten Zeiten in Tirschenreuth irgendeine größere Feier stattfand, wurden Fischgerichte serviert. Allmählich erhielt diese Gegend die Bezeichnung „Land der tausend Teiche“. Bis heute haben wir in Tirschenreuth drei Karpfenzüchter, die davon leben können. Im Gegensatz zu anderen Teilen Deutschlands werden hier Karpfen immer noch als Weihnachtsgericht gegessen.
Der größte Schlag für Tirschenreuth in der ganzen Geschichte war wohl der große Brand im Jahre 1814. Nur ein paar Häuser blieben damals unversehrt. In wenigen Jahren war doch die Stadt größer und schöner wiederaufgebaut. Mit dem Bahnanschluss 1872 verwandelte sich Tirschenreuth rasch zur Industriestadt. Nur Mitterteich war einige Jahre früher dran, weil es auf der Linie Weiden – Eger (Cheb) lag. Viele Fabriken entstanden neu in Tirschenreuth wie eine Tuchfabrik, eine Walzenfabrik und eine Glasfabrik. Sie konnten nun mit der billigeren Braunkohle aus böhmischem Falkenau an der Eger (Sokolov) befeuert werden. Allmählich setzte sich die Porzellanherstellung durch. In den besten Jahren arbeiteten hier in den Porzellanfabriken bis zu tausend Leute. Zu dieser Zeit gingen die Mägde und Burschen von den Bauern weg, weil sie in der Stadt einen regelmäßigen Verdienst und feste Arbeitszeit erwarteten. Tirschenreuth ist damals praktisch explodiert. Jedes Stück Raum wurde vermietet. Die stürmische Entwicklung kam mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende, danach kam die Inflation. Nach 1923 ging es der Wirtschaft langsam wieder besser, was aber nicht für die Porzellanfabriken galt.
Am meisten hat sich die Stadt 1945 verändert. Es kamen viele Flüchtlinge, darunter viele intelligente und erfahrene Leute. Sie hatten nichts, mussten neu beginnen, aber es hat auch etwas Neid bei der einheimischen Bevölkerung ausgelöst. Aus fünftausend Einwohnern waren plötzlich achttausend geworden. Neulich las ich eine Anzeige aus dem Jahre 1951. Eine junge Frau bietet darin die Heirat einem Mann katholischer Konfession an. Flüchtling zwecklos, lauteten die letzten Worte. Das waren nämlich Leute zweiter Kategorie. Während einer Generation, also binnen etwa 25 Jahre, haben sich die neuen Einwohner mit den alten vermischt und leben seitdem im guten Einklang zusammen.
Den inzwischen letzten, aber umso kräftigeren Sprung hat die Stadt erlebt, als Franz Stahl 2002 zum Ersten Bürgermeister gewählt wurde. Seit dieser Zeit hat sich das Aussehen der Stadt stets zum Positiven verändert. Der Marktplatz wurde generalsaniert, der ehemalige obere Stadtteich wieder geflutet und wo einst der Müll der Stadt gelagert wurde, ist eine Parkanlage und ein Großparkplatz entstanden. Tirschenreuth ist eine Vorzeigestadt, in der man sich wohlfühlt und in der es sich gut leben lässt.