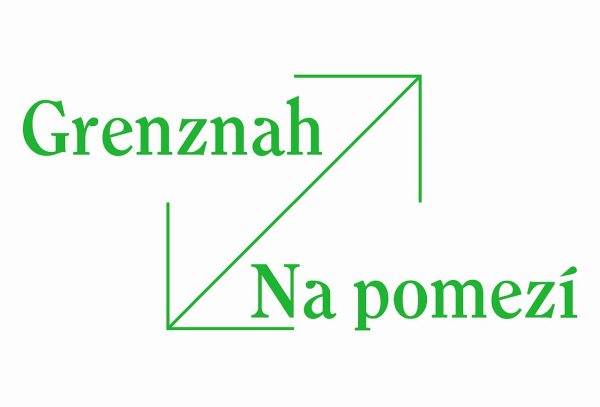Mein Bild ist wie das Streicheln einer armen Seele
Gespräch mit Jan Knap
Jan Knap, geboren 1949 in Chrudim, ist Maler. Sein Thema ist bereits seit dreißig Jahren die Heilige Familie. Er ist in Plan (Planá) bei Marienbad (Mariánské Lázně) ansässig, nachdem er vorher in Deutschland, Brasilien, den USA und Italien gelebt hat. Er hat vier Kinder. Der folgende Text basiert auf Gesprächen, die in den Jahren 2017–2018 geführt wurden. Die Unterhaltung verlief schrittweise und gemächlich, in Jan Knaps Haus oder im angrenzenden Atelier. Für das aufgenommene Material bot sich eine Gliederung in die vier Bereiche ,Biografie‘,,Das Haus in Plan‘, ,Kunst‘ und ,Das Bild‘ an.
,Das Bild‘ enthält die Gespräche über ein großformatiges Werk, das über mehrere Monate hinweg entstanden ist. Die Form dieses Abschnitts wurde so gewählt, dass der Leser sich ohne nähere Erklärung im Inneren des Schöpfungsprozesses wiederfinden kann. Das Thema ,Das Haus in Plan‘ ist für Jan Knap und für die Stadt Plan wichtig. Es dürfte sich wohl um die zugleich einfühlsamste wie einfallsreichste Restaurierung eines alten Hauses in der gesamten Region handeln.
Biografie
Ich bin in Marienbad aufgewachsen. Als Kind in einem Kurort aufzuwachsen bedeutete, dass Autos aus dem Westen kamen. Straßenkreuzer. Wir schauten auf ihre Tachometer. Sie zeigten beispielsweise unglaubliche 240 km/h. Wir hatten deutsches Fernsehen. Mein Vater sprach seit der Kindheit Deutsch und hatte es im Konzentrationslager perfektioniert. Die nahe Grenze nahm ich als Barriere wahr. Wir hörten Geschichten über Drähte, Hunde, Schüsse. Niemand von meinen Freunden diente an der Grenze. Das war eine Arbeit für die Burschen aus Mähren. Wir Tschechen aus Westböhmen waren wohl infiziert. Den Eisernen Vorhang habe ich nie gesehen, obwohl ich nur 15 km von ihm entfernt wohnte. Die Welt endete irgendwo in der Gemeinde Dreihacken (Tĭi sekery). Als ich aus der Tschechoslowakei floh, dachte ich überhaupt nicht daran, über diese Grenze zu gehen. Bis heute hege ich eine Art eingeimpftes Misstrauen gegen die nahe Grenze. Vielleicht stammt das sogar aus der Kindheit. Als Jugendlicher habe ich niemanden getroffen, der die Sowjetunion gelobt hätte. Der Schuldirektor war natürlich Kommunist, er erzählte uns Dummheiten im Fach Bürgerkunde, aber ich erinnere mich an keinen Mitschüler, der ihm geglaubt hätte. Ich wusste nur von den Vätern der Mitschüler, die den Kommunismus ausnutzten, um Karriere zu machen. Wir wuchsen in einer Atmosphäre auf, in der Wahrheit das genaue Gegenteil von dem war, was der Rundfunk sendete. Mein Vater war in den 50er Jahren eingesperrt, weil ihn jemand denunziert hatte, als er einen Kommentar zu Gottwald machte. Bei uns herrschte also politisch Klarheit. Aber wir wuchsen doch unter schizophrenen Bedingungen auf. Mein Vater schimpfte auf die Kommunisten, obwohl wir von Mutters Seite her ein Gründungsmitglied der Partei und sogar einen kommunistischen Minister in der Familie hatten. Das waren aber Kommunisten der Ersten Republik. Gebildet und fremdsprachenkundig, zwangen sie mir ihre Überzeugung nicht auf.
Meine Erinnerungen an das Marienbad meiner Jugendzeit sind negativ. Für mich war das ein Ort ohne Aussicht. Rundherum Hügel. Das Leben war für mich die mährische Hanna, wohin ich in den Ferien fuhr. Sie bildeteeinen Kontrast zu Marienbad, wo immer Schnee lag oder es regnete. Eine ständige Kälte. Marienbad ist für mich eine Stadt der Kellner, Devisenbetrüger und Taxifahrer. Einer seltsamen Unterwelt. Meine Mitschüler machten Jagd auf die Urlauberinnen. Ich war schüchtern. Der Ort, an dem ich meine Jugend verlebte, war für mich eine leere Welt. Ich habe die Tschechoslowakei nicht verlassen, um ein besseres Leben zu haben und mir ein Auto zu kaufen. Ich folgte der Kunst. Ich wollte Bilder sehen.
Ich ging im Jahr 1969, nachdem sich Jan Palach verbrannt hatte. Ich war 18 Jahre alt. Meine Eltern waren schon im Ausland. Ich hatte keinen Pass. Das einzige Land, in das man ohne Reisegenehmigung gelassen wurde, war Ungarn. Ich fuhr nach Szeged, ging dort über die Grenze nach Serbien. Von dort mit dem Zug nach Koper in Slowenien, damals war beides noch Jugoslawien. Weiter zu Fuß über die Grenze. Nach Triest. Es war dunkel und es regnete, aber ich ging dem Licht entgegen, das hinter den Hügeln schien. Als ich die weißen Plastikleitpfosten sah, sagte ich mir, dass dies schon Italien sein müsste, was sich dann bestätigte, als die ersten Reklametafeln auftauchten.
Ich war voller Schlamm, weil ich ein paar Mal hingefallen war. Ich zog mich aus und wusch meine Kleidung in einer Pfütze. Die vorbeifahrenden Autos hupten. Drei Monate habe ich in Italien in einem Lager verbracht, dann floh ich zu meinen Eltern nach Deutschland. In dem Lager in einem Dorf bei Triest waren überwiegend Albaner, aber auch ein paar Russen und Tschechen. Aus Albanien kamen ganze Familien, Großmütter, Großväter. Sie ließen niemandendort zurück, das war beeindruckend. Ich habe mich nicht einmal umgeschaut, ob ich jemanden vergessen hatte. Das Lager funktionierte ein bisschen wie ein Gefängnis. Ich kletterte über die Mauer, auf die sie mich gehievt hatten. Per Anhalter fuhr ich zunächst nach Wien, dann nach Deutschland. Die Deutschen gaben mir eine Aufenthaltserlaubnis. Ich wollte aber nach Brasilien, weil mir der Film ,Abenteuer in Rio‘ mit JeanPaul Belmondo in der Hauptrolle gefallen hatte.
Nach Brasilien reiste ich dann ein paar Monate nach der Ankunft in Deutschland ab. Ich benutzte das Geld, das mir die Deutschen für einen Deutschkurs gegeben hatten. Das waren 2500 Mark. Viel Geld. Ich ging durch die Straßen und sah, dass die Schiffspassage nach Brasilien 2450 Mark kostete. Meine Eltern verabschiedeten sich am Kölner Bahnhof von mir. Meine Mutter weinte. Ein Flugzeugticket kostete damals das Doppelte. Die Schiffsreise dauerte eine Woche. Mein Schiff fuhr von Genua und hieß Julio Caesar. Auf dem Schiff gab es Schwimmbecken, im Kino wurden Filme gezeigt und an den Tanzböden spielte die Musik. Ich hatte keinen Heller, daher konnte ich die Attraktionen nicht sonderlich genießen. Aber das Essen war luxuriös. Dreimal täglich plus Brotzeit. Während der Passage unterhielt ich mich vor allem mit den Arbeitern. Italienern, die in Brasilien oder Argentinien arbeiteten und zu Besuch nach Hause gefahren waren. Sie hatten bemerkt, dass ich allein war, und mich gleich angesprochen. Eine angenehme Gesellschaft, kleine stämmige Neapolitaner. Sie luden mich sofort zum Wein ein.
Rio de Janeiro war zu meiner Zeit noch romantisch. Die Stadt bestand aus längeren und kürzeren Stränden. Santa Barbara gehörte zur Altstadt. Dort erhebt sich der bekannte Zuckerhut. Heute befindet sich ein Strand in der Stadtmitte, der zu meiner Zeit noch an deren entferntem Rand lag. Ich hielt mich Anfang der 70er Jahre in einem noch übersichtlichen Rio auf, wo keine für mich sichtbaren Rassenprobleme existierten. Als ich in Rio vom Schiff ging, hatte ich 100 Mark. Ich bezahlte ein Hotel für fünf Tage. Danach fand ich ein Zimmer in der Altstadt. Es war Winter, die Temperatur lag bei unter 15 Grad. Fenster ohne Glas, nur Fensterläden mit Jalousien. Keine Decke. Mir war kalt. Die Menschen waren freundlich. Den ersten Monat über war ich irgendwie blockiert, ich konnte mir nichts Portugiesisches merken, aber danach ging es besser. Die Sprache habe ich schnell gelernt. In Rio blieb ich ein Jahr. Auf dem Schiff hatte ich einen Amerikaner getroffen, der mich in Rio mit Tschechen bekannt machte, die bereits mehrere Generationen in Brasilien lebten. Sie sprachen kein Tschechisch mehr. Die Familie Vaňátko. Der alte Herr Vaňátko hatte es bis zum größten Juwelier in Brasilien gebracht. Sein Sohn war Philosoph, damals bereits ein älterer Herr. Die Familie Vaňátko sagte mir, dass bei ihnen jeden Tag für 12 Personen gedeckt werde. Es sei egal, ob 12 Personen kämen oder ob ich allein bei Tisch säße. Ich könne mich setzen und mich sattessen. Ich müsste auch niemanden grüßen, wenn ich keine Lust hätte. Der Amerikaner vom Schiff stellte mich auch einem russischen Juden vor, einem Kunsthistoriker, der Kurator der Biennale in Sao Paulo war. Mit ihm sprach ich noch Russisch.
Einmal stand ich auf der Straße, an der Ecke war ein Imbiss, ich habe wohl den Duft eingesogen. Bei mir blieb ein Mensch stehen, von größerer, kräftigerer Gestalt. Er holte aus mir heraus, dass ich keine Bleibe hatte. Er sagte mir, ich solle mit ihm kommen, sein Großvater hätte eine Tierarztpraxis und das Geschoss darüber sei frei. Dort fänden sich noch zahlreiche freie Zimmer. Ein anderer Schlafgast war Schweizer. Und so kam ich allmählich unter Menschen. Allerdings ging mir auf, dass dies kein Ort für mich war.
Jemand, der in einer egalitären sozialistischen Gesellschaft aufgewachsen war, konnte dort nicht leben. Man hat einfach nicht den Nerv dafür. Man trinkt irgendwo mit anderen Leuten ein Bier in einem Restaurant. Am Fenster kleben Menschen und schauen dich an. Die Menschen auf der anderen Seite der Glasscheibe werden sich nie im Leben ein solches Bier kaufen können. Es kostet 25 Cruzeiros und der Mann hinter der Scheibe verdient täglich 2 Cruzeiros. Er arbeitet elf Stunden. Man muss entweder dort geboren sein oder den Nerv dafür haben. Charakteristisch sind die unzähligen Sambaschulen. Beim Karneval fahren die Wagen und darauf wird getanzt. Jede Frau möchte dort oben tanzen und die Interessanteste sein. Für das Kostüm spart sie das ganze Jahr über. Für ein Jahr Ersparnisse will sie einen Moment lang auf dem Wagen tanzen.
Ich versuchte zu arbeiten, ich bemalte Bijouterie bei einem Tschechen. In einem Monat hätte ich nicht einmal die Miete für ein einzelnes Zimmer verdient. Die Menschen arbeiten dort für nichts. Ich war mit der Frage, wie ich Arbeit finden könne, sogar bei Voodoo-Zauberern. Sie rieten mir, einen Zweig unter das Kopfkissen zu legen, was ich nicht getan habe. Der Philosoph, Herr Vaňátko, riet mir, mich lieber an den Strand zu legen.
Aus Langeweile ging ich auch zur tschechoslowakischen Botschaft. Ich sprach Portugiesisch und gab nicht zu verstehen, dass ich Tscheche bin. Auf dem Gang führten Diplomaten obszöne Gespräche. Glattfrisierte Stasileute in typischer Kleidung gingen nach hinten. Geöffnete schwedische Hemden. Es kam wohl niemand in unsere Botschaft, schon gar kein Tscheche. Es gab keine Pförtnerloge, nichts. Ich fragte, wo ich erfahren könne, wie man jemanden nach Rio einlädt – natürlich sagte ich keinen Namen. Sie schickten mich in ein Büro, wo mir ein Angestellter eine Antwort gab. Ich bewegte mich frei und verließ die Botschaft nach ungefähr einer halben Stunde. Ich erzählte meine Erlebnisse Herrn Vaňátko. Er sagte: „Das darfst du nicht, sie hätten dich festnehmen können.“ In Washington war ich in der Botschaft, als ich bereits die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte. Dort sah es anders aus, es gab doch einen gewissen Betrieb. Vielleicht einen Spionagebetrieb. Man trat durch einen merkwürdigen Hintereingang ein, wo nach einer Zeit des Wartens ein Fensterchen mit einer Größe von 15 x 15 cm aufging. Dort erhielt man „njet“ zur Antwort, egal, ob es um ein Visum oder eine Einladung ging. In beiden Botschaften der gleiche Eindruck. Schmutz und eine unschöne Welt. Die damalige Tschechoslowakei. Nach einem Jahr ging ich in Brasilien als Seemann an Bord und verließ das Schiff in Rotterdam. Von Rotterdam fuhr ich mit dem Zug nach Köln und ging von dort nachts zu Fuß 35 km zu meinen Eltern. Dort aß ich mich satt und brachte mich wieder in Form. Dann arbeitete ich im Sägewerk. Mit Portugiesen, die begeistert waren, dass ich Portugiesisch sprach. Wunderbare Menschen, eine wunderbare Sprache. Noch schöner als das Italienische. Italienisch ist gewöhnlich, Portugiesisch hat ein Geheimnis. Dann ging ich nach Düsseldorf zur Kunstakademie. Ich fand Professor Sackenheim, bei dem kaum jemand eingeschrieben war. Ich zeigte ihm meine Zeichnungen. Er sagte: „Hervorragend, kommen Sie im September, Herr Knop!“ In Prag war das deutlich komplizierter. Beflissen sagte ich ihm, dass ich bis dahin besser Deutsch lernen würde. „Wieso, Sie sprechen doch tadellos.“ Ich war glücklich. An der Akademie lernte ich Milan Kunc kennen. Ich hielt es dort ein Jahr aus. Das zweite Semester bei Gerhard Richter. Danach reiste ich nach Amerika ab. Ich war entschlossen, nichts mehr mit Kunst zu tun haben zu wollen. Ich fuhr nach Amerika, um ein ehrliches Leben zu führen.
Nachdem ich mich entschieden hatte in Amerika zu leben, begab ich mich nach Frankfurt zur amerikanischen Botschaft. Ein ungefähr 50-jähriger Referent sagte mir, dass ich keine Chance hätte. Dann riet er mir aber doch, es über die Wohlfahrt zu versuchen. Einen Monat später saß ich in einem Flugzeug, das sie mir bezahlt hatten. Mit Libanesen, mit Christen, die geflohen waren. Nach der Ankunft brachten sie mich in ein Hotel, bezahlten mir dort eine Woche Unterkunft und besorgten mir eine Arbeit. Ich erhielt eine Aufenthaltserlaubnis, eine Green Card. In Amerika konnte ich atmen. Ich bin überzeugt, dass ich dort sein sollte. Dort gelangte ich zum Glauben. Amerika betet noch. Irgendwo dort habe ich die europäische Kleinheit abgestreift. Ich wollte nur arbeiten, der Kunst ausweichen, aber es gelang mir nicht. Die Künstlerexistenz in Amerika ist traurig. Ein Künstler arbeitet beispielsweise zehn Jahre an einer Sache. Wenn er das Gefühl hat, er habe eine Stil gefunden, erhält er eine Chance. Er macht eine Ausstellung. Wenn er nichts verkauft, ist er bis zu seinem Tod erledigt. Allein in New York gab es zehntausend Galerien. 260 000 Künstler zahlten Steuern. Das heißt, dass sie mehr als 8000 Dollar verdienten, sonst bezahlt man dort keine Steuern.
Ich habe zehn Jahre in Amerika gelebt und viel geschafft. Zuerst habe ich nur gearbeitet. Dann ließ es mir keine Ruhe und ich versuchte, Illustrationen für Kinderbücher anzubieten. Ich hätte mehr daran arbeiten müssen, um Erfolg zu haben. Es zog mich heraus aus New York. Eine Weile arbeitete ich als Gärtner in Montana. Danach ging ich nach San Francisco. Ich hatte kein Geld und hungerte. Ich trieb mich an einem kleinen Platz herum. Dort stand ein Häuschen, darin fesche Kerle in Uniform. Ein schwarzer Sergeant kam heraus. Er sagte mir: „Du willst etwas mit deinem Leben anfangen.“ Ich folgte ihm in das Häuschen und unterschrieb dort für sechs Jahre Dienst in der Armee. Aber es sollte noch drei Tage dauern, bis sie mir zu Essen gaben. Jemand sagte mir, dass ich im Kloster bei den Franziskanern essen könne. Dort gab es einen Speisesaal. Ich blieb dort auch über Nacht. Dann setzte ich mich in den Militärautobus und danach ins Flugzeug nach San Diego. Alles war schön, alle höflich. Danach begann der Drill. Uns froren die Gesichtszüge ein. Gebrüll und Tritte.
Ich war schon 23. Ich hatte einen gewissen Überblick. Aber die 18-jährigen Jungs? Niemand war bisher so mit ihnen umgesprungen. Hochgewachsene Jungs aus Texas. Einer stürzte sich auf den Ausbilder und schrie, dass er ihn hassen würde. Man schickte ihn nach Hause. Der Zweck des Gebrülls bestand darin festzustellen, wer überhaupt psychisch für den Soldatendienst geeignet war. Die Abteilung hatte 50 Soldaten. Jeden Monat blieben nur 25 über. Man fügte zwei Abteilungen zusammen und machte weiter. So ging es dreimal.
Es gab dort auch sehr starke Jungs. Sie hielten es nicht aus. Sie brachen zusammen. Die Armee wollte dich kleinmachen und sehen, wie du reagierst. Es war Schikane, aber von der fairen Art. Sie sollte sicherstellen, dass ein Soldat nicht zusammenbrach, wenn er sich im Kampf befand. Bei der Armee blieb ich ein knappes Jahr. Dann stellten sie eine Gesundheitsstörung fest, eine chronische Mittelohrentzündung. Damals war ich bereits bei den Fallschirmjägern und dort hätte das gestört. Sie zahlten mir ein Flugticket nach New York. Ich wurde ehrenhaft aus der Armee entlassen, das war ein offizieller Terminus. Für den Neuanfang erhielt ich eine einmalige soziale Unterstützung. Meine einzige Unterstützung, die für zwei Wochen reichte. Danach war ich zwei Jahre in einem buddhistischen Kloster, in einem Naturschutzgebiet, ungefähr 150 km von New York entfernt. Mäzene hatten dort die Kopie eines japanischen Klosters aus dem 12. Jahrhundert errichten lassen. Dauerhaft waren wir dort ca. 25. Einmal im Monat kamen Menschen von außen, weitere ca. 20 Personen. Sie kamen um zu meditieren. Im Kloster wirkte ein japanischer Meister. Die Sutras wurden auf Japanisch rezitiert. Man las Koans. Texte, bei denen die alten Meister zur Erleuchtung gelangt waren. Wir arbeiteten, zum Beispiel im Ahornwald, wo wir Ahornsirup gewannen. Die Haupttätigkeit war das Sitzen. Werktags saß man fünf bis sechs Stunden. Der Zyklus war so eingestellt, dass das Sitzen sich verlängerte und Texte zu Buddhas Erleuchtung memoriert wurden. In sieben Tagen erreichte man den Punkt, an dem man den ganzen Tag und die ganze Nacht saß. Natürlich wurden Essenspausen gemacht. Erstaunlich ist, dass man dann nicht schläft. In der letzten Nacht hast du eine Stunde geschlafen. In der vorletzten Nacht zwei Stunden. Und so weiter. Niemand schlief ein. Man betrachtet dann sein eigenes Gedächtnis von innen. Alles taucht auf, man glotzt es an. Mit funkelnder Klarheit geht es nach hinten von Gedanken zu Gedanken. Als betrachte man einen Film. Das Sitzen dauerte immer 45 Minuten, danach lief man 10 Minuten. Man beherrscht die Atmung. Ich weiß, dass ich schließlich 45 Mal geatmet habe und der Gong erklang. Danach begann mir etwas zu fehlen. Ich hatte Dienst im Heizraum. Mir wurde bewusst, dass etwas stehen geblieben war. Ich stellte fest, dass ich im Kloster nichts mehr zu tun hatte. Ich kehrte nach New York zurück. Zunächst tat mir das ein bisschen leid. Die Beine hatten sich bereits an den Lotossitz gewöhnt, es tat überhaupt nicht weh. Es war so, als hätte man ein Musikinstrument erlernt und dann einfach damit aufgehört. Mit der Kunst habe ich mich in Amerika wenig beschäftigt, aber ich reiste nach Europa, um meine Eltern zu besuchen, und brachte immer Bilder mit, die wir dann ausstellten. Die Ausstellungen organisierte Milan Kunc. Durch sein Verdienst haben wir uns zu dritt in gewisser Weise in das Bewusstsein eingeschrieben. Als Gruppe Normal, zusammen mit Peter Angermann. Wir hatten uns an der Akademie kennengelernt. Alles entstand spontan, als wir gemeinsam einige Bilder malten. In dieser Zeit war es vollkommen absurd ein Bild zu malen. Natürlich existierte immer eine Art zweite Liga. Leute, die für sich Stillleben malten. In der Kunstszene, über die man sprach, und in den untereinander verflochtenen guten Galerien existierte etwas Derartiges jedoch nicht.
Wir waren zu dritt und hatten Lust zu malen. Ich muss sagen, dass Peter Angermann mich mit seinen Bildern auf die Malerei angesetzt hat. Er ist ein Maler. Mich faszinierte, dass man malen kann, und ich begann ebenfalls. Dabei ging ich ein wenig von meinen Versuchen zur Kinderbuchillustration aus, in denen die Familie eine Rolle spielte. Die gemeinsam gemalten Bilder erwiesen sich als interessant, daher wurden wir zu einigen Ausstellungen eingeladen.
Milan Kunc und Peter Angermann kamen auch zu mir nach New York, wo wir ebenfalls gemeinsam malten. Ich bin von Natur aus ein Perfektionist. Ohne die beiden würde ich wohl immer noch an meinem ersten Bild malen. Jahrzehnte hindurch. Mit ihnen war es eine Befreiung. Ich malte auf einem gemeinsamen Bild einen Tiger. Ich fragte: „Peter, was denkst du?“ Und er: „Gut, male jetzt den Elefanten.“ Und so habe ich den Elefanten gemalt. Ich schaute zu, wie sie Farben mischten. Sie mischten sie völlig anders als ich es tat. Ich war immer noch bei Rot, Blau, Grün. An der Akademie hatte ich einst Stillleben gemalt. Das war alles, die Farben musste ich lernen. Das war befreiend.
Peter ist ein offener, freundlicher Mensch. Ohne Ambitionen. Er hat keine großen Ziele. Er stellt sich nicht auf den Kopf. Milan ist sehr ehrgeizig. Er war der Motor, der die Ausstellungen besorgte, die Kritiker überzeugte, dass sie etwas schrieben. Er zerrte uns auf die höchste Ebene, was die Bekanntheit anbelangt. Wenn die Gelegenheiten, die Milan Kunc organisiert hat, nicht existiert hätten, dann hätte ich nicht angefangen zu malen. Wir haben alle gearbeitet. Die Bilder verkauften sich nicht, aber die Aktionen fanden statt.
Wenn aus Deutschland die Nachricht nach New York kam, dass wir eine Ausstellung haben würden, malte ich ungefähr ein Bild pro Monat. Einige Bilder schickte ich per Post und Milan spannte sie dann auf und regelte alles. Milan Kunc ist auch Tscheche, er hatte das Land ebenfalls nach 1968 verlassen. Einmal hatten wir ein Pressegespräch. Sie fragten uns, du bist Tscheche, du bist Tscheche, Kunc, Knap und Peter Angermann ist Deutscher. „Aber ich bin zwei Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt geboren“, protestierte Peter.
Damals waren die Neuen Wilden gefragt. Wir sagten uns, dass dies im Deutschen wie ein Wortspiel klingt – die Neuen Milden. Die damaligen Kenner hielten Milan Kunc für den Besten. Peter lebt in Nürnberg, daher weckte er Interesse als jemand, der sein Werk zuhause erschafft. Unsere künstlerischen Wege erwiesen sich als sehr unterschiedlich, aber Freunde sind wir bis heute. Wir sehen uns selten.
In New York war die Malerei für mich ein Randphänomen. Ich dachte hauptsächlich darüber nach, wie ich mich taufen lassen sollte. Ich unterschied nicht zwischen Protestanten und Katholiken. Mir wurde bewusst, dass sich die älteste Kirche in New York unten in Manhattan befand. Eine große Holzkirche, die von den Mährischen Brüdern errichtet worden war. Ich begab mich dorthin. Die Kirche war leer, es standen Tischtennisplatten darin. Schwarze Jungs betrieben ein Pingpong-Geschäft. Das war gut, aber ich suchte etwas anderes. Ich erinnerte mich, dass es an der 75. Straße auf der Ostseite eine Kirche des hl. Johannes von Nepomuk gab. Sie war einst von Landsleuten erbaut worden, dort gab es eine tschechische Siedlung. Ich suchte sie auf. Dort wirkte ein hervorragender Priester. Ein Slowake. Pater Javor. Er sagte mir, dass man sich nicht einfach so taufen lassen könne. Ich fragte wieso nicht. Als Philippus den Ägypter traf, sagte er ihm: „Siehe, da ist Wasser, was hindert‘s?“ Ich hatte Glück. Er war ein Jesuit, er hatte die Welt als Missionar durchwandert. Ich putzte Hochhausfenster. Bis zur Taufe blieben einige Monate. Plötzlich bekam ich Angst vor diesen Fenstern. Was, wenn ich fallen würde? Ich sprach mit dem Pater darüber. Er sagte mir. „Fürchte dich nicht. Es gibt drei Arten der Taufe. Mit Wasser, Blut und Sehnsucht. Selbst wenn du fällst, bist du getauft.“
Mein Pate war Salvator Manzi, ein gelähmter Pförtner aus dem Hotel, in dem ich früher einmal gearbeitet hatte. Ein Freund vermittelte mir dann einen Aufenthalt bei tschechischen Katholiken in Chicago. Dort war Pater Vojtěch Vít tätig, bei der Kirche der damals noch seligen Agnes von Böhmen. Von dort ging ich zum Theologiestudium an das Nepomucenum in Rom. In Chicago sind die Tschechen auf dem Rückzug. Dort, wo Masaryk wirkte und es tschechische Kirchen gab, ist heute alles mexikanisch.
Das Christentum führte mich zurück nach Europa. Das Nepomucenum in Rom kannte ich bereits von früher. Als ich während der Ferien in Europa war, hatte ich mir in Rom eine Publikation der Kĭesťanská akademie [Christliche Akademie] gekauft, die dort ansässig war. Ich kam mit dem Rektor des Nepomucenums, Monsignore Vrána, ins Gespräch, der mir sagte: „Du bist allein, ein Christ, was, wenn du eine Berufung hast? Komm im September.“ Also lernte ich über die Ferien Italienisch und kam. Das war 1982. Ich blieb bis 1984 dort. Unser Geistlicher Ratgeber war Pater Špidlík. Ich ging sehr selten zu ihm, ungefähr einmal im Monat. Einmal sagte er zu mir: „Du machst alles hundertprozentig. Schule, Verhalten. Und trotzdem bist du unzufrieden.“ Mir war gar nicht aufgefallen, dass ich unzufrieden war. „Lass es“, sagte mir Pater Špidlík. Am gleichen Tag erhielt ich einen Brief von Kaspar König, der große Ausstellungen organisierte. Er bereitete ein Projekt vor, das er ,Von hier aus‘ genannt hatte. Er lud uns ein. Am gleichen Tag, an dem mir Pater Špidlík zur Theologie gesagt hatte: „Lass es.“ Als ich wegging, waren die anderen geschockt, weil es eigentlich keinen Grund für den Abgang gab. Keiner der Würdenträger redete mit mir. Nur der Vizerektor ging vorbei, als ich in einer Gruppe von Seminaristen stand. Er blieb stehen und sagte: „Ich habe gehört, dass du weggehst, lass bloß keine Unordnung zurück.“ Mir kam es fast so vor, als ob ich protestieren und dort bleiben sollte. Aber ich hätte wohl kein Pfarrer sein können. Man konnte allerdings nach der Weihe als Beichtvater arbeiten. Das hätte mir gefallen. In Wallfahrtsorten. Sich kompetent mit Dingen beschäftigen, die normale Pfarrer nicht tun sollten.
Statt Priester wurde ich also Maler. Ich war bereits 35, ich sagte mir, dass ich mich dem ganz widmen würde. „Auch wenn du nichts zu essen haben solltest, wirst du malen“, sagte ich mir. Ich malte ein Bild, auf dem die Jungfrau Maria bügelt und das Jesuskind unten unter dem Bügelbrett spielt. Ein Gynäkologe kaufte es und hängte es in seinem Wartezimmer auf. Meine künftige Frau sah das Bild und kam, um mich kennenzulernen: „Ich habe noch nie gebügelt, aber ich bin gegangen und habe mir ein Bügelbrett gekauft“, sagte sie mir dann.
Ich erhielt eine Einladung für eine erste Einzelausstellung in Ilverich nahe Düsseldorf. Hans-Jürgen Müller sah die Ausstellung. Damals habe ich das Thema Heilige Familie noch nicht gemalt, nur gezeichnet. Ausgestellt wurde das Bild eines Mönchs. Das war das erste Ölgemälde, das ich mit teuren Farben gemalt hatte. Ich hatte mehrere Tage daran gearbeitet, es war wirklich ein „ausgemaltes“ Bild. Müller war ein großer, mächtiger Mann und eine bekannte Kapazität. Er hat unter anderem das Buch ,Kunst kommt nicht von Können‘ geschrieben. Das stimmt so zwar nicht, das Buch habe ich auch nie gelesen, aber er war ein kluger Mensch, der etwas zu sagen hatte. Er kam zu mir und sagte: „Du malst für mich das, das, das…“ Er ging an meinen Zeichnungen der Heiligen Familie vorbei, zog eine Rolle 1000-Mark-Scheine heraus und zählte mir einen Vorschuss ab. Ich tat wie geheißen. Er veranstaltete dann eine Ausstellung, die Paul Maenz besuchte. Ihm gehörte die beste Galerie für zeitgenössische Kunst in Köln. Bevor ich in diese Galerie gelangte, hatten die Leute mich ausgelacht. Von da an herrschte Ruhe. Ich war jemand, der von Paul Maenz ausgestellt wurde, und meine Bilder verkauften sich alle noch vor der Ausstellungseröffnung. Das war eine schöne Zeit. Das Thema der Heiligen Familie war eine Bombe. Es gab Menschen, die mich nicht mehr grüßten, weil sie mich für einen Dummkopf und Reaktionär hielten. Dann gab es Leute, die nicht wussten, was die Stunde geschlagen hatte. Die Heiligenscheine malte ich redlich. Das war nicht üblich. Ein Bild habe ich Paul Maenz für die Kunstmesse in Köln gemalt. Sein Stand gehörte zu den ersten, die das Fernsehen auf der Messe besuchte. Mein Bild war im Fernsehen.
Mehrmals täglich klingelte mein Telefon und man bot mir eine Ausstellung an. Ich beschäftigte mich nicht damit, die Ausstellungen organisierte Paul Maenz. Sein Mitarbeiter de Vries sagte – „Mensch, ihr habt da eine Luft.“ Die Leute plapperten Selbstverständlichkeiten, die man mir mit 15 hätte sagen können. Wenn ich Flächen male, streiche ich sie nicht einfach an. Die Fläche braucht mehr Farben. Der Himmel ist Blau, aber hinein kommt auch Grün, Grau, er erhält warme wie kühle Töne. Dann entsteht Raum in dem Bild. Früher sagte der Meister zum Lehrjungen: „Nimm dir Grau und schaue, was es macht.“
Dann schloss Paul Maenz seine Galerie. Das Geschäft widerte ihn an. Er war ein Mensch, der sich ernsthaft für Kunst interessierte. In Amerika macht man mit dem Galeriebetrieb Politik, man täuscht etwas vor, das nicht wahr ist. Es werden Sachen verkauft, die eigentlich niemand möchte. Und so bin ich Ende der 1980er Jahre nach Italien gegangen. Der Galerist Toselli in Mailand nahm sich meiner an. Er war ein Kenner und ein sehr anerkannter Galerist. Der Umzug nach Italien hatte auch einen praktischen Grund. Die Steuern in Deutschland nahmen mir einen Großteil meines Einkommens weg. In Italien war das damals anders. Wer dort keinen ständigen Wohnsitz hatte, durfte gar keine Steuern zahlen. Wir wohnten in Modena. Zwei Kinder brachten wir aus Deutschland mit, das Nächste wurde in Italien geboren. Das letzte Kind kam dann in Wischau (Vyškov) zur Welt.
Währenddessen änderte sich in der Tschechoslowakei die Situation. Eine Bekannte rief mich an: „Jan, in der Tschechoslowakei passiert etwas.“ Ich antwortete: „Da besteht keine Gefahr.“ Dann rief mich der Rundfunk aus Wien an, damit ein Maler ihnen das Geschehen kommentierte. Ich sagte, dass ich sofort zurückkehren würde, wenn sich bei uns die Verhältnisse änderten. Ich sagte meiner deutschen Frau, dass einer von uns zuhause wohnen sollte. Wir zogen 1992 um. Wir begeisterten uns auch für die Idee, ein Haus auf dem Dorf zu kaufen, damit die Kinder in Ruhe aufwachsen konnten. Daher zunächst die mährische Hanna, dann Plan.
Dreißig Jahre lang hatte ich keine fertigen Bilder zu Hause. Sie entstanden immer für eine Ausstellung und kehrten nicht mehr zurück. Bilder, auf denen die Heilige Familie zu sehen ist. Aber ich hatte Christ werden wollen, weil ich mir sagte, dass ich heilig sein möchte. Es ist traurig, dass ich es nach vierzig Jahren immer noch nicht bin. Wir kommen zum Ende. Das Ende wird gleich sein, ob jetzt oder in hundert Jahren. Ein staunenswerter Moment des Abgangs. Ein Übergang irgendwohin, wovon wir keine Ahnung haben, aber Gott hat es uns versprochen. Gott ist unser Schuldner geworden, nicht weil wir ihm etwas gegeben hätten, sondern weil er uns etwas versprochen hat. Uns ist die Gelegenheit zum ewigen Leben gegeben worden. Ich habe wenig getan. Das Leben endet. Nur noch ein paar Jahre. Alles ist wundervoll. Ich freue mich.
Das Haus in Plan
Erst in Plan begriff ich, wie man mit einem alten Haus arbeiten kann. Welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. In der Hanna habe ich ein Haus renoviert und fertiggebaut, das als das älteste Haus am Dorfplatz galt. Ich fand einen guten Zimmermann und baute, wie ich es mir dachte. In Plan war das ganz anders.
Jirka Šlégl tauchte auf. Zunächst machte er mir das Portal. Ich wusste, dass das Haus ein Portal hatte, aber ich wollte es neu gemacht haben. Dann übernahm Jirka Šlégl das gesamte Gebäude. Er brachte noch andere geschickte Handwerker mit. Zum Beispiel einen Schmied, der Nachbildungen von Barockschlössern schuf. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass es noch jemanden gibt, der das kann. Zunächst fiel ich in die Hände einer Firma, die sich angeblich mit Baudenkmälern befasste, aber eigentlich nur alles aus Beton goss. Sie war mir von Denkmalschützern aus Pilsen empfohlen worden. Jirka Šlégl riss alles heraus, was die Firma gegossen hatte. Wahrscheinlich hätte ich sonst den Hausschlüssel in den Abwasserkanal geworfen und wäre weggegangen. Die Firma war brutal. Ohne Gefühl für die Sache. Nur Geld war wichtig. Von dem Haus sind schließlich die ursprünglichen Außenmauern stehen geblieben. Der Teil in Richtung Platz ist ein gotisches Haus aus dem 14. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert wurden die übrigen Häuser am Platz nach oben um ein Geschoss erweitert. Dieses Haus nicht, es wuchs Richtung Hof. Vor meiner jetzigen Küche steht die Rückwand des gotischen Hauses. Das Haus hat sich also im Vorderteil die gotische Disposition bewahrt. Wenn man bei uns Gotik sagt, stellen die Leute sich ein Kreuzgewölbe vor. Das gilt beispielsweise für Wohnhäuser in St. Joachimsthal (Jáchymov), wo die einstigen prächtigen Wohnhäuser der Bergstadt völlig zerstört sind. In Plan waren die Verhältnisse ärmer. Es hat mich gefreut, dass eine Fotografie des Hauses, das ich restauriert habe, bei einer Ausstellung gotischer Kunst in Westböhmen gezeigt wurde. Als Beispiel für ein typisches Bauwerk der Gotik.
Das Gebäude habe ich in wirklich schrecklichem Zustand gekauft. Ich wollte ein Haus am Platz, damit ich rausgehen, eine Zeitung kaufen und mich ins Café setzen könnte. Die Zeitung kann man nicht lesen und das Café öffnet spät. Ich stehe früh auf, um neun Uhr habe ich bereits Mittag, beim Café ist das also kein Vorwurf. Bei der Zeitung schon. Trotzdem bin ich sehr gern in Plan. Die Fassadengestaltung mit Sgraffito-Feldern ist nicht ausgedacht. Jirka Šlégl hat Fragmente entdeckt. Er hat sie vermessen und ein Netz geschaffen. Bis nach oben stimmte alles genau. In gotischer Zeit war der Giebel aus Holz. In der Renaissance wurden zwei Balken aufgestellt und eine dünne Wand gebaut.
Damals nahm der Putz die jetzige Gestalt an. Ich wollte eine schöne Fassade. Ich bin überzeugt, dass in Plan früher Häuser mit Fassaden in Kratztechnik standen. Als die Maurer die Renaissance-Fassade des Schlosses vollendet hatten, wollten die Bürger natürlich etwas Vergleichbares. Die entdeckten Reste hat Jirka Šlégl als Stil der Frührenaissance identifiziert. Die spätere Variante ist schwarz.
Ich habe nicht erwartet, dass ich mich in Plan niederlasse. Meine Mutter lebte nach der Rückkehr aus dem Exil in Deutschland in der Nähe von Tachau (Tachov); wir fuhren sie dort besuchen. Frau Mrovcová, die in Plan lebt und aus Kremsier (Kroměĭíž) stammt, hörte von mir als einem Maler. Sie kam zu mir nach Seltsch (Želeč) wo wir nach der Rückkehr aus der weiten Welt lebten. Sie hatte in Plan eine kleine Galerie und wollte eine Ausstellung machen. Ich stimmte zu. Sie zeigte mir das Haus und sagte: „Jan, kauf es.“ Sie wollte hier einen Gleichgesinnten haben.
Das Haus wuchs dann und gefiel mir immer mehr. Ich baute mir im Hof ein Atelier. Endgültig ließ ich mich 2004 hier nieder. Ich zog in ein unfertiges Haus. Ich warf die Firma raus, die jeden Monat 300 000 Kronen wollte, ohne dass sich etwas Sichtbares tat. Sie waren keine Betrüger, aber sie wirtschafteten schlecht. Ich war für sie eine Geldquelle, der sie nur versprechen mussten, was sie gleich alles tun würden. Jirka Šlégl ist ein herausragender Maurer und Steinmetz. Er besitzt Autorität, er lehrt an der Hochschule. Alles wurde fortlaufend fotografiert und eine Dokumentation geführt.
In den 50er Jahren ist jemand über den Planer Platz gegangen und hat ein maschinengeschriebenes Heft zu den Bauwerken erstellt. In diesem Haus stand im ersten Raum ein mächtiger Steinkamin. Er war offen, der Rauch wälzte sich an der Decke. So feuerten sie. Dem Herrgott in die Fenster. Der Rauch zog durch ein Loch unter der Decke zwischen den Fenstern ab. Einen Meter vor dem Kamin war es heiß, danach schon kalt. An den Wänden lief wohl das Wasser herunter. Aber der Holzwurm hat das Räuchern ganz sicher nicht überlebt. Im Durchgang befand sich dem Heft zufolge eine gotische Schnitzsäule, die die Balken stützte. Sie wurde wohl zersägt und verbrannt, mit Details hat man sich damals nicht beschäftigt. Schade, dass niemand sie fotografiert hat. Ich würde eine Kopie anfertigen lassen.
Das Haus gehörte der Invalidengenossenschaft (Družstvo invalidů). Ich habe in Plan Menschen getroffen, die hier arbeiteten. Niemand von ihnen hatte eine Behinderung. Im Keller stand das schmutzige Wasser bis zur Taille, darin schwammen Stühle. Ekelhaft. Morast. Schlamm. Sie hatten noch nicht einmal Türen dort. Direkter Kontakt mit dem Gestank. Darüber das Büro. Unglaublich, dass der Chef nicht gesagt hat: „Wir schmeißen das raus und schaffen eine Pumpe an.“ Im Hof stand ein großer Metallhangar. Zum Haus führte eine Betonrampe. Wenn ich sage, dass wir 100 LKW-Füllungen mit Müll, Ablagerungen und Material abgefahren haben, glaube ich nicht, dass ich übertreibe. Mächtige Betonschichten. Überall. Am Zaun stand ein niedriges Gebäude mit drei Räumen. Wohl aus den 60er Jahren. Miserabel gebaut. Es musste abgerissen werden. Mein heutiger Ausgang in den Garten befand sich eigentlich unter der Erde. Die Ablagerungen waren so hoch, dass ich dachte, es handele sich um einen weiteren Keller. Das Haus war eigentlich zum Teil vergraben.
In gotischer Zeit stand das Haus wohl auf einem kleinen Hügel, das Terrain fiel dann ab und dort, wo heute die Gasse verläuft, war eine Schlucht. Mein Nachbar ist das Kino-Gebäude. Ich wurde gebeten, meine Mauern an die Isolierung des Kinos anzuschließen. Wir haben 180 cm tief gegraben. Es existiert keine Isolierung der Kino-Fundamente. Soldaten haben das gebaut, sie hatten ein Loch ausgehoben und Ziegel hineingeworfen. Daher haben wir unter die Fundamente des Kinos eine Isolationsschicht geschoben. Bei der Renovierung des Hauses habe ich gesehen, wie unglaublich hier gewirtschaftet worden ist. In dem zur Straße gelegenen Raum hatten sie ihr Büro. Wohl das Hauptbüro. Alles war mit einer merkwürdigen grünen Farbe angestrichen. Sperrholzplatten bis zur Decke trennten einzelne Kojen ab. Vom Kamin aus dem Heft fanden sich natürlich keinerlei Spuren. Sie hatten Öfen dort. Die in den Steinschornstein führten, der keinen Abzug hatte.
Ich habe mich zu Plan durchgegraben. Zu einer Stadt, in der Kaiser Sigismund den Kreuzzug gegen die Hussiten versammelte. Sicher haben bei mir die Adligen gelebt. Auf dem Hof dann die Söldner. Tausende gerüstete Männer. Ab dem 16. Jahrhundert, in das die Aufzeichnungen zurückreichen, wohnten Metzger in dem Haus. Vor dem Krieg ein Hutmacher. Er brach das Portal ab, richtete eine schmale Tür und eine Auslage ein. Hutmacher Franz Klima. Das Portal habe ich in der Gestalt rekonstruiert, wie sie in der Region auftritt. Eine alte Abbildung hatte ich nicht. Ich habe gelernt, die Stadt wahrzunehmen, und ich mag sie gern. Ich wäre froh, wenn die Burg restauriert würde. Die Besitzer, die Herren von Seeberg, müssen gute Diplomaten gewesen sein, wenn sie Hussiten und Kreuzritter überstanden haben. Hier ist die Schwester König Georgs von Podiebrad begraben. Und die Schlick prägten hier Münzen.
Plan ist zweifellos ein interessanter Ort. Er hat ein historisches Gesicht und historisches Gewicht. Die romanische Peter-und-Paul-Kirche ist fantastisch. Joseph II. hatte sie aufgehoben. Er hinterließ wirklich ein Chaos, der gute Joseph. Man spricht immer davon, wieviel während der Hussitenzeit zerstört worden ist. Allerdings wurden die meisten Dinge nach den Hussiten noch zweimal wieder aufgebaut. Das spirituelle Ortsnetzwerk hat das Vorgehen von Joseph II. allerdings nicht überlebt. Das kann man auch in Norditalien sehen, das zu Österreich gehört hatte. Im Stadtzentrum steht ein ehemaliges Kloster, das zu Wohnungen umgebaut wurde. Weiter südlich findet man das nicht. Ein Kloster bleibt ein Kloster, es ist ein Ort der Stille und der spirituellen Arbeit. Joseph II. hob die kontemplativen Orden auf, sodass die Seele der Nation noch einen Schlag erhielt. Das ist bis heute zu sehen. Als ich in Antwerpen gemalt habe, ging ich morgens in eine Kirche, bei der sich ein Karmeliterinnenkloster befand. Die Kirche war in L-Form gebaut. Auf der einen Seite die Öffentlichkeit, hinter dem Gitter die Ordensschwestern. Das Kloster mit Garten stand direkt im Zentrum der Stadt. Und in der Stadt war das zu spüren. Die Menschen beteten dort.
Plan hat mir immer mehr gefallen. Ich habe hier viele Dinge entdeckt, die einen Wert haben. Und die sich weiter entwickeln lassen. Wenn man die Burg restauriert und mit dem Platz verbunden hat, wird das noch eine Stadt sein, die Begeisterung weckt. Wenn der neu renovierte Platz fertig ist, wird es eine wirklich schöne Stadt sein. Die helle Pflasterung gefällt mir. Die Menschen sind nicht daran gewöhnt, sie sagen alles Mögliche, ich hätte auch manches anders gemacht, aber insgesamt gesehen ist es gut. Der Bereich rund um die Pestsäule ist wirklich hübsch. Am Platz finden sie kein nicht renoviertes Haus mehr. Das ist auch nicht selbstverständlich. Den Menschen wird es allmählich besser gehen. An der Stadt wird das weiter zu sehen sein.
Kunst
Das Leben ist für mich ein Drama. Dramen müssen nicht laut sein, von Posaunen und Trommeln begleitet. Ein Drama kann auch ein stilles Lied sein. Ein solches Lied möchte ich in meine Bilder einfügen. Ich gebe meinen Bildern das Drama, das ich spüre. Im Leben gibt es nichts Alltägliches. Alles ist ein Ereignis. Die meisten Menschen nehmen das Leben als etwas Normales. Es ist aber nicht normal. Das ist der Knaller.
Ich habe einmal ein Gitarrenkonzert von Julian Bream gehört. Die Melodien waren so süß, dass sie mich geradezu zerspalteten. Genau das war es. Ich wollte ein solches Bild malen. Es ist interessant, dass bei allen Religionen, sei es Hinduismus oder Buddhismus, der visuelle Ausdruck ins Süße geht. Daher hätte ich auch keine Angst vor dem Süßen. Es ist bei allen gleich. Vor kurzem habe ich mir mystische Zen-Gedichte gekauft. Eine ganz andere Kultur. Seit dem 5. Jahrhundert, praktisch bis heute. Es ist erstaunlich. Natürlich verehren sie nicht Gott, Christus. Diesen erschienenen Gott, den wir als Christen kennen. Er ist in verständlicher Form erschienen. Ich sehe aber, dass Gott den Menschen in keiner Zivilisation leer zurückgelassen hat. Wir haben hier eine Aufgabe. Der Mensch soll sich ändern, sich verbessern, an sich arbeiten. Es geht um ein Voranschreiten. Das Bild ist keine Realität, Wirklichkeit, Fotografie. Auch keine Veranschaulichung der Sache. Das Bild ist ein Fenster in eine tiefere Realität. Zumindest sollte es das sein. Durch die sichtbaren Dinge hindurch. Und durch den Schatten, den die sichtbaren Dinge werfen. Du zeigst auf einem Bild etwa einen Hut auf einer Kanne. Aber ich spüre, dass dies, wenn es gut gemacht ist, eine Atmosphäre erschafft, die den Menschen nach vorne treibt. Man muss von dem ausgehen, was ist. Von unterscheidbaren Dingen. Die abstrakte Malerei ist für mich vollkommen überflüssig. Jahrzehnte habe ich abstrakt gemalt. Ich weiß, was ich sage. Aus dem, was wir sehen, können wir das sehen, was sich dahinter befindet.
Es ist ein Hineinblicken, eine Berührung der wahrhaften Realität. Nicht dessen, was ich sehe, sondern dessen, was sich dahinter befindet. Man begreift, dass hinter allem, was uns umgibt, hinter allem, was wir erleben, was wir sind und was wir tun, ein Sinn steckt. Wir leben in einem lebendigen Geheimnis. Unser Leben ist unglaublich.
Das Bild wirkt auf den ganzen Menschen. Wenn das Bild gut ist, muss es auch aus der Nähe wirken, auf Berührung, auf Riechen, auf alles. Bei einem guten Bild findest du dich in der Realität wieder. Nicht im Anschein. So sollte es sein. Das sind Richtung und Ziel, wie Tyrš zu sagen pflegte. Man muss sich bemühen. Delacroix sagte, dass es die erste Pflicht eines Bildes sei, eine Augenweide zu sein. Mit dem Auge auszuruhen. Wenn das gelingt! Es gibt so viele Dinge, die man nicht malen kann.
Bei Kompositionen bleibe ich immer bei Nummer vierzehn stehen. Ich füge sie dort ein, manchmal nachträglich. Meist bleibt es aber bei der Anzahl stehen. Man muss zeigen, dass das Geheimnis immer gegenwärtig ist. Dass wir, beschränkt wie wir sind, nur sehr selten wahrnehmen. Nicht vergessen. Unsere heutige Welt versucht das Geheimnis zu verdrängen. Als unnötig. Ausgedacht. Was sich irgendwelche Leute ausgedacht haben. Es geht darum, im Leben einfach Luft zu holen. Freude zu haben, dass für die Dinge gesorgt ist. Dass die Welt Gott sei Dank nicht nach unserem Wollen eingerichtet ist. Dass sie nicht mit unserem stumpfen Gehirn geordnet ist.
Das Bild muss ein Gebilde sein. Mir gehen kahle, glattrasierte Bilder auf die Nerven, auf denen sich nur eine Figur befinden darf. Das hat sich so nach dem Krieg etabliert. Deshalb habe ich mit den Kompositionen begonnen. Das Bild muss ein Konglomerat vieler Dinge sein. Farben, Geometrie, es muss eine kleine Maschine bilden, die dann in Ruhe vor sich hin schnauft. Ein gutes Bild ist ein Spiegel, in dem sich der Mensch augenblicklich widerspiegelt. Er findet sich selbst. Ein Bild ist für Menschen, die ihr Innenleben pflegen. Kunst hat diese Funktion. Das ist keine Unterhaltung.
Wahrhaftige Malerei ist eine Meditation über das Leben. Sich bewusst machen, worin man lebt, dass es sich um eine komplexe Angelegenheit handelt, und dann mit dem besten Gewissen darauf reagieren. Es ist eine Begegnung mit dem Herrgott. Er kennt alle meine Schritte. Er ist der Einzige, der es letztlich bewerten kann. Bei Cézanne ist das Bild schrecklich arbeitsaufwändig gemacht, aber auf den ersten Blick ist da nichts. Man kann es auf den ersten Blick lesen, aber Gott sieht dort die Redlichkeit. Ich glaube, dass es gerade darum geht. Es gibt bekannte zeitgenössische Maler, bei denen ich nur Spekulation und Lüge sehe. Dort gibt es keine Kunst mehr. Die Kunst erhebt den Menschen zu höheren Dingen.
Grobheit ist aus einem schrecklichen Erlebnis entstanden. Daraus, dass den Menschen etwas auf den Schultern lastet. Grobheit kommt nicht von Gott. Sie kommt vom Bösen. Zynismus gehört überhaupt nicht in die Kunst. Ich muss das Drama mildern, nicht verstärken. Ich gestehe zu, dass beispielsweise Matthias Grünewald große Sachen gemalt hat. Ich habe seinen Altar in Karlsruhe gesehen. Ein großer Maler, der mir aber seinem Geist nach fremd ist. Ich mag die böhmische Gotik. Zum Beispiel die Tafel aus Namiescht (Náměšť), die sich in der Brünner Galerie befindet. Das sind mächtige Dinge. Ein Kopf ist einmal groß, ein anderes Mal winzig, die Arme kurz. Aber es ist ein großzügiges Bild. Als Maler bin ich von Cézanne fasziniert. Ich bewundere, wieviel er gewagt hat. Der gotische Künstler aus Mähren hat es ebenfalls gewagt. Wenn die Maria Magdalena aus seinem Bild treten würde, gingen ihr die Figuren in der Umgebung bis zur Taille. Aber sonst wäre sie nicht so zu sehen, wie sie zu sehen sein soll. Das Bild ist eine Möglichkeit der Betrachtung. Dass Auge soll ruhen. Der Mensch betrachtet dann sich selbst. Für mich ist Kunst nur das. Der Mensch macht sich Dinge bewusst, an die er sonst nicht denken würde. Ich schäme mich immer für meine Bilder. Ich kann mich nicht erklären. Ich bin unsicher. Es sind zu große Dinge, als dass ich sie mit Worten bewältigen könnte.
Mein Bild ist wie das Streicheln einer armen Seele. Das Vergnügen eines einsamen Menschen. Der Gehalt meines Bildes ist der Dienst. Die Freude, jemandem zu dienen. Wie oft habe ich jemandem den Weg gezeigt und zehn Minuten später ging mir auf, dass ich ihn in die falsche Richtung geschickt hatte. Und dieser Mensch geht. Ich habe ihn falsch geschickt. Ohne Absicht. Wenn er es merkt, muss er umkehren. Es gibt keine andere Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Ich kann auch völlig falsch liegen. Aber das Streicheln, das Küssen, dieser Dienst, da kann der Mensch sich nicht irren. Christus der Herr sagte: „Liebe deinen Nächsten.“ Da kann man sich nicht vertun. Deshalb mag ich in der Kunst keine absoluten und abstrakten Konstruktionen, bei denen eine Linie um einen halben Millimeter verschoben wird.
In New York bin ich ins Kino gegangen. Sensationelle Filme. Aber man kommt heraus und alles fällt auf einen nieder. Das sollte Kunst nicht tun. Kunst soll dich erheben, dann siehst du die Welt, ihre Schwierigkeiten, in einem anderen Licht. Ich weiß nicht, ob dies so bei einem Menschen funktioniert, der nicht gläubig ist, der kein Christ ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn ein Mensch mit einem solchen Erlebnis nicht gläubig ist, steht er doch schon mit einem Bein im Glauben. Er weiß, dass das Leben einen Sinn hat, und einen Sinn kann es haben, wenn dahinter ein Jemand steht. Das ist Kunst für mich: Die Anbindung an den Sinn. An das, was wir brauchen.
Den Dingen, die du tust, musst du eine Form geben. Es muss etwas Verwendbares entstehen, ohne Rücksicht auf die Größe. Bevor ich konvertiert bin, war ich bei den Buddhisten, vorher bei den Theosophen. Je weniger verständlich ein Buch war, desto mehr kam es mir vor, als enthalte es das, was ich suchte. Das war Rebellion und Rebellion ist heute bereits ein Klischee. Die letzte Tür, die mir einfiel, hinter der noch etwas sein könnte, war die christliche, katholische Tür. Ich dachte mir, dass dort bestimmt nur ein Putzeimer mit Lappen und Besen steht. Und öffnete die Tür.
Die Leute nehmen von vornherein eine ablehnende Haltung zum Christentum ein. Manche argumentieren mit den Kriegen. Sie sagen, Gott würde sie nicht zulassen, wenn er existierte. Mein Vater war im Konzentrationslager und unter den Kommunisten im Gefängnis, in den Joachimsthaler Urangruben. Er kehrte verbittert zurück, man konnte kaum noch mit ihm reden. Er suchte nur nach Unterhaltung. Er sagte, dass er im Konzentrationslager erkannt habe, dass es keinen Gott gäbe. Nie würde ich Menschen mit solchen Erfahrungen verurteilen. Ich war während meines Lebens nie wirklichen Prüfungen ausgesetzt. Ich habe Hunger kennengelernt. Ich war in einer Welt, wo ich niemanden kannte und die Sprache nicht beherrschte. Aber in anscheinend ausweglosen Situationen habe ich festgestellt, dass ich nicht allein auf der Welt bin. Dass jemand die Hand über mich hält. Ich glaube, dass Gott am Ende auch meinen Vater berührt hat. Er hatte es verdient. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Während ich mich dem Ende nähere, wird mir bewusst, dass es auch nicht anders sein kann, als dass der Mensch sich keinen Rat weiß. Die Liebe zum Schöpfer zeigt sich in der Zähigkeit. Darin, nicht aufzugeben.
Camille Pissarro pflegte zu sagen, dass er, wenn er ein Bild zu malen beginne, sich vorstelle, dass er einen Phönix male, der in allen Farben funkelt. Aber dann krieche nur ein nasses Huhn hervor. Das, was wir in uns haben. Aber wenn nur etwas von dem ins Bild gelangt, was man fühlt, könnte dies auf einen anderen Menschen wirken. Etwas berühren, was dann von selbst sein eigenes Leben lebt. Wenn das Bild gemalt wird, sollte es atmen und sein eigenes Leben leben. Heute kenne ich das, aber früher war ich überrascht, wenn das Bild atmete. Ein lebendiges Bild. Wenn ein Bild gelingt, habe ich das Gefühl, dass ich, kurz gesagt, an etwas gerührt habe.
Das Bild
Das erste zeitgenössische Bild mit der Heiligen Familie, das mich ansprach, stammte von Peter Angermann. Alle drei in der Wanne. Es ist weder ein böses noch ein ironisches Bild. Peter gab mir diese Idee. Als ich mit 30 Jahren Christ wurde, hatte ich das Bedürfnis, diese Sache ein wenig auszuschlachten. Damit man es wusste. Warum es immer geheim halten? Einmal habe ich eine Kritik einer meiner Ausstellungen in Italien gelesen, in der gefragt wurde, ob ich so heilig sei oder bloß so clever. Die Figuren müssen sich nicht ansehen. Aber sie müssen eine Gemeinschaft bilden. Alle kennen sich. Es muss ein zwar nicht geschlossener, aber doch vertrauter Figurenkreis sein. Sie wissen voneinander. Sie gehören zueinander. Einer arbeitet für den anderen.
Jemand sagte mir, dass Joseph immer abseits stehe, dass Maria und Joseph sich umarmen sollten. Aber das gehört nicht hierher. Warum, weiß ich nicht. Sobald sie sich ansehen oder anlächeln, sind wir auf der Erde. Dann ist es nichts mehr, das Tendenzen hätte, auf etwas Anderes zu verweisen. Auf etwas Höheres.
Ein Engelchen ist dazugekommen. Ich weiß nicht, ob es hier bleibt. Die Gitarre ist fast verschwunden. Ein Bein ist verschwunden. Man kann nicht beide Beine verdecken, denn sonst ist nicht zu sehen, dass das Engelchen steht. Niemandem darf einfallen zu fragen, ob es steht und wie es steht. Es muss glaubwürdig sein. Wenn man eine Sache ändert, muss man zehn weitere Sachen ändern. Manchmal genügt es, wenn man auf dem Bild einen Stuhl verschiebt.
Es kommt vor, dass in dem Verhältnis, wie es sein sollte, plötzlich eine Figur einen zu kleinen oder zu großen Kopf hat. Das ist wie eine Maschine, bei der man ein Rad wechselt und plötzlich läuft es nicht mehr rund. Bei Brandl ist Routine zu sehen. Die habe ich nicht. Ich muss jedes Detail ausdenken.
Etwa dieses Gesicht. Wie oft habe ich es schon gemalt. Der Betrachter soll sich vor dem Bild bewusst werden, dass unser Leben etwas mehr ist als das, was wir sehen. Die Buddhisten sagen, dass die Welt nicht das ist, was wir vor uns wahrnehmen, aber sie ist auch nichts anderes. Sie hat einen anderen Anfangspunkt als das, was wir vor uns haben. Oder Ingres sagte seinen Schülern im Atelier, bevor sie zu malen begannen: „Vergesst nicht, dass das Modell vor euch nicht das ist, was ihr malen wollt. Weder im Hinblick auf die Farbe noch im Hinblick auf die Form. Aber ihr könnt nicht auf es verzichten. Das ist der Sinn des Bildes.“
Hier ist der Engel verschwunden. Etwas ging dort nicht. Organisatorisch. Ich habe den Engel mit Gitarre verschoben. Ursprünglich stand er ganz nahe. Es gab keinen Raum zu dem Roten. Jetzt ist es entlastet, nachdem ich ihn verschoben habe. Es sieht vielversprechend aus. Ob es so bleibt, weiß ich nicht. Ich habe das Ganze verschoben. Jetzt kommen die interessanten Details. Der Engel wischt sich den Schweiß ab. Er schuftet. Mit einem Spaten in der Hand. Hierher kommt ein Lilienbeet. Es kommen noch zahlreiche Dinge hierher.
Mit den Kindern im Vordergrund gibt es ein Problem. Man kann sie nicht in Überlebensgröße malen, das wäre monströs. Drumherum ist zu viel Raum. Ich kann ihn füllen. Mit kleineren Dingen, denn wenn ich dort einen Baum malen würde, zerfiele das Bild in zwei Teile. Hierher kommen Körbe, Kaninchen, Schmetterlinge, Vögel, Kannen. Es wird eine Augenweide für diejenigen, die sehen wollen. Ich habe die Figuren vergrößert, die Kinder in der ersten Ebene waren läppisch. Es hatte kein Gewicht. Ich habe sie um circa 20 cm vergrößert. Es ist nicht fertig, vielleicht mache ich die Tür noch ein Stückchen kleiner. Sie wirkt zu sehr wie ein Portal. Ich kann es nicht abschätzen. Ich bewundere die Künstler der Mánes-Familie, die ein Bild 30 x 20 cm zeichneten, eine präzise Zeichnung, die sie mit einem Gitterraster versahen, dann übertrugen sie sie auf eine Leinwand mit Gitterraster und alles saß. Mánes musste nichts ändern. Er schätzte es richtig ein. Ein paar Mal habe ich das auch gemacht. Ich habe eine Zeichnung vergrößert und dann festgestellt, dass es so überhaupt nicht passte. Das Jesuskind wird auch ein bisschen größer. Die Tür habe ich etwas niedriger gemacht. Nur minimal. Wenn man sich einen Erwachsenen vorstellt, passt er durch die Tür. Proportionsfragen haben keine Logik. Sie müssen so gemacht werden, dass es richtig aussieht. Nicht so, dass es präzise ist. Man kann es messen und es wird schlecht aussehen. Das ist für mich die größte Arbeit. Ich kenne in Italien ein gotisches Kloster, wo der Architekt die Perspektive absichtlich so gewählt hat, dass das Gebäude größer aussieht. Ich schiebe hin und her, bis es richtig ist. Ich muss in die Musikschule gehen und mir ein interessantes Detail mitbringen. Wie ein Kind eine Geige hält. Ich kann mir das ausdenken. Häufig ist es so, dass man verzweifelt schaut, wie etwas in Wirklichkeit aussieht. Und dann feststellt, dass man es nicht verwenden kann. Also kehrt man zu dem zurück, was man sich ausdenkt, aber freier, weil man weiß, dass es so sein muss.
Das ist Arbeit, hin und her. Das kann sich niemand vorstellen. Es ist die Suche nach Gott. Ich denke, dass Gott sich freut, wenn der Mensch sich so anstrengt. Es wird gesagt, dass Rembrandt bei einem Porträt zwei Tage lang den Hut hin und her geschoben hat. Bis es passte. Aus irgendeinem rätselhaften Grund existiert nur eine Position, die richtig ist. Bei diesem Porträt, bei diesem Gesicht, bei diesem Menschen. Um Natürlichkeit zu ergänzen, damit das entsteht, was die Figur erfordert. Der Sachcharakter, der angedeutet wird. Ich kenne Maler, die – wenn etwas nicht geht – es irgendwie fingieren und weitermachen. Das mache ich nie. Die Galeristen haben das verstanden. Sie ließen mich immer erst die Bilder fertigmachen und veranstalteten erst dann die Ausstellung. Ansonsten ist es üblich, dass ein Ausstellungstermin vereinbart wird und die Bilder bis zu diesem Zeitpunkt fertig sein müssen.
Die Bibel lese ich jeden Tag. Ich sehe dort mein Leben und meine Probleme. Die Geschichten kenne ich, ich habe sie mehrfach gelesen. Auf dem Bild geht es auch nicht darum, wer wohin läuft. Das Thema ist die Reflexion. Der Mensch kennt sich und fügt sich in die
Bibellektüre ein. Wenn ich das Handwerk respektiere und weiß, dass eine Sache dienstbar sein soll, müssen Material und handwerkliche Arbeit dem entsprechen. Darauf bezieht sich die Form. Die Kultur. Dann sieht das auch nach dreißig Jahren noch anständig aus. Hinter der Arbeit steht auf lange Zeit die – ununterbrochene – Handwerkstradition. Das alles hat man aufgegeben. Unsere Zivilisation verliert die Fähigkeit, etwas Kreatives und Gültiges zu erschaffen. Das will auch niemand mehr.
Ich möchte es so haben, dass ich mich nicht dafür schämen muss. Morgen ist der Festtag des heiligen Joseph. Daher werde ich ihn malen.