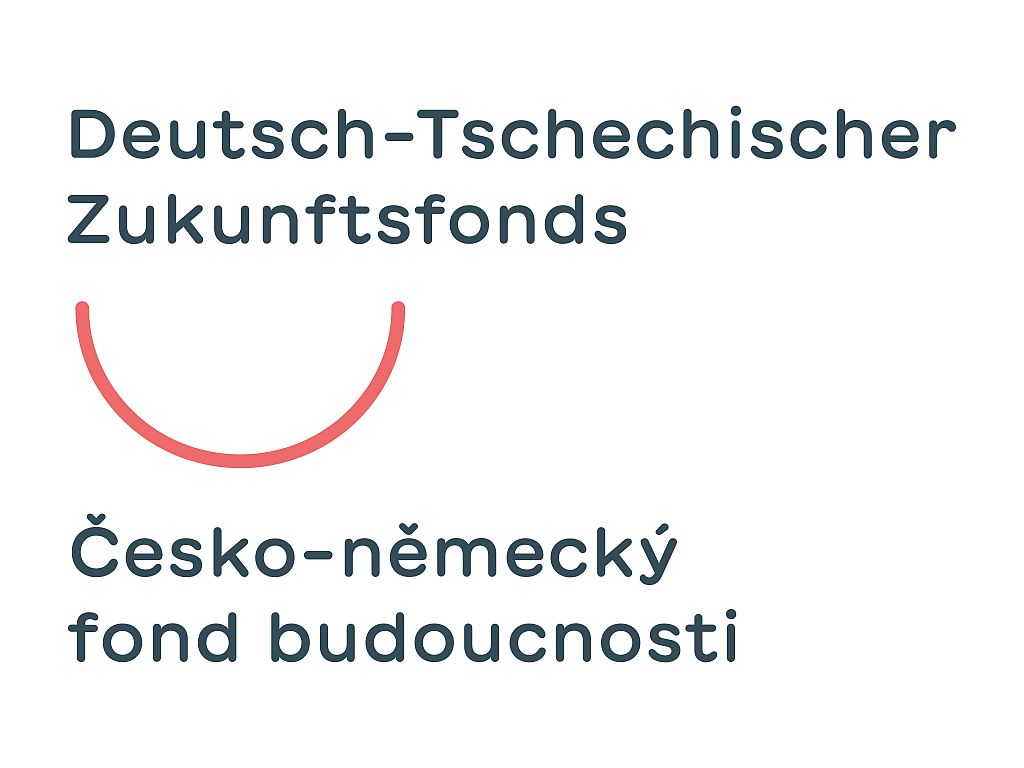Wir wollten eine Zivilgesellschaft aufbauen
Gespräch mit Michaela Mertlová
Warum sind Sie nach Plan (Planá) gekommen und was war Ihr erster Eindruck von der Stadt?
Wir sind aus dem Norden, aus Leutensdorf (Litvínov) hergekommen. Mein Mann ist Markscheider. Er hatte angefangen sich Sorgen zu machen, dass man die Gruben in Nordböhmen wohl langsam schließen würde. Dann hat er sich nach einer anderen beruflichen Laufbahn umgesehen. Er hat sich dann mit Uranbergwerken in Westböhmen in Verbindung gesetzt. Hier wurden wiederum Schächte geöffnet. Sie haben ihn mit offenen Armen empfangen. Sie hatten kaum Leute mit Erfahrung. Da hat er dann am 1. Januar 1975 angefangen. Ich war damals 28 Jahre alt. Als klar wurde, dass wir umziehen werden, haben wir eine Wohnung gesucht. Erst wurde uns eine in Marienbad (Mariánské Lázně) angeboten. Das war nur so eine Art Köder. Dann haben sie versucht uns Tachau (Tachov) aufzudrängen. Die habe ich mir angeschaut und gesagt, dass wir diese Wohnung auf keinen Fall nehmen werden. Wir haben gewartet. Sie haben uns gesagt, dass es eine Wohnung in Plan für uns geben wird. Das hat sich wieder hingezogen und wurde nichts. Mein Mann hat gekündigt, weil der Arbeitgeber nicht das erfüllt hat, was er ihm versprochen hatte. Das ging hin bis zu einem Gerichtsverfahren. Dort hat der Rechtsanwalt des Betriebs dann eine Verfügung mit einer Wohnung in Plan aus der Tasche gezogen. Dass sich darin der Vormieter erhängt hatte, haben wir erst später erfahren. Im Oktober 1975 sind wir eingezogen. So richtig wollten wir nicht, weil wir in Leutensdorf unser privates Umfeld hatten. Beide Familien, eine schöne, große Wohnung, ein Wochenendhaus zur Erholung im Erzgebirge. Wir haben gewusst, dass wir ein Haus bauen wollten. Wir hatten alles abgesprochen, dass ein Freund der Familie nachkommen würde wegen einer ähnlichen Position, wie mein Mann sie hatte. Er hat seine Stelle hier auch angetreten, aber er hat die gesundheitliche Untersuchung nicht bestanden. Wir haben uns nach jemandem umgesehen, der mit uns bauen würde. Uns hatte eine bestimmte Parzelle gefallen, aber die war nur für ein Doppelhaus zu bekommen. Wir haben dann angefangen uns hier umzuschauen. Aus Leutensdorf waren wir an ein umfangreiches gesellschaftliches Leben gewöhnt. Ich hatte Glück. Im Uranabbau arbeitete ein Lehrer, der nach Achtundsechzig aus seinem Beruf hinausgeschmissen worden war. Er kam ursprünglich aus Mähren und hatte gute Kontakte zum Leiter des Kulturzentrums in Plan. Er hat ihn nach einer Stelle für mich gefragt. Das erste, was ich nach dem Umzug nach Plan gemacht habe, war, dass ich mich in der Bibliothek angemeldet habe. Ich habe so Leute über Kultur kennengelernt. Das mit der Stelle hat dann durch einen Bekannten im Kulturzentrum geklappt und ich wurde Verwalterin für zwei Schulen der Stadt. Die Schulen waren eigenständig, hatten aber nur einen Verwalter. Die Lehrer sind sie eine „Kaste“ für sich, sie haben kulturelles Interesse, ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Wir haben uns relativ schnell einen Bekanntenkreis geschaffen, der sich allmählich vergrößerte. Neunundachtzig haben wir mit weiteren Seelenverwandten das Bürgerforum gegründet und die Wahlen gewonnen. Ich wurde Sekretärin in der Stadtverwaltung und bin dort bis zur Rente geblieben. In meiner Funktion als Sekretärin bin ich an viele Informationen und Dokumente herangekommen, das hat mir Spaß gemacht. Wir haben uns also ganz gut integriert.
Was hat es damals bedeutet, Uran zu finden? Die Schächte wurden ausgebaut, das war ein strategischer Zweig. Eine überwachter? Eine privilegierter?
Uran ist schließlich etwas anderes, als Kohleabbau. Die Uranbergwerke entwickelten sich in der damaligen Zeit sehr. Der Hauptschacht wurde in Hinterkotten (Zadní Chodov) ausgebaut. Als Hauptvermesser musste mein Mann, wie man so sagt, den Buckel hinhalten. Viel Zeit konnten wir nicht mit ihm verbringen. Und dazu haben wir angefangen zu bauen. In den Bergwerken brauchten sie qualifizierte Leute. Mein Mann war bei allen angesehen, viele gab es nicht wie ihn. Ein Freund von uns, der hier keine Stelle bekommen hatte, hat uns gefehlt – er ist zwei Jahre später bei einer Explosion in der Grube „Pluto“ umgekommen. Er war der Erste, den sie tot gefunden hatten, damals sind dort über sechzig Bergmänner geblieben. Wir waren froh, dass wir hier gelandet waren. Mein Mann ist dann von Hinterkotten in die Grube nach Tillenberg (Dyleň) gegangen, von wo aus sie nach Deutschland schauen konnten, hinter den Eisernen Vorhang.
Haben Sie hier vor 1989 manchmal die Grenze gesehen?Nein. Schon seit Jahren fahren wir jetzt dorthin in die Pilze. Mein Mann hat mir gezeigt, wo das Holz zwei Meter hoch aufgeschichtet gewesen war. Er hat erzählt, wie die Jungs zum Austreten dorthin gegangen sind, absichtlich zum Holz, weil sie wussten, dass sich darin Grenzbeamte verstecken. Jedenfalls hat man sich das so erzählt. Der Schacht war technisch völlig gesichert. Ein Steinbrecher ist abgehauen. Auch sonst hat man hier erzählt, dass einige versucht haben, die Grenze zu überqueren. Aber nicht so viel, die Leute hatten Angst über bestimmte Sachen zu sprechen.
Wie sah der Betrieb im Kulturzentrum in den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts aus? Das Kulturzentrum hatte seinen Sitz dort, wo heute die Bibliothek ist. Da haben ungefähr fünf Leute gearbeitet. Außer dem Kulturprogramm hat man ideologische Arbeit für die Schulen gemacht. Pflichtprogramme, viele Unterhaltungen mit jungen Menschen, „Jugend und Kultur“ hieß das. Aber nicht nur uninteressante, kommunistische Sachen. Es gab da einen guten Kinoleiter, der auch Leute vom Film nach Plan brachte, die sonst auf das Festival in Karlsbad (Karlovy Vary) fuhren.
War der hiesige Bezirk sehr kommunistisch? Selbstverständlich. Im Schloss von Plan saß das Kommando der Grenzwache. Die hiesige ältere Siedlung war ursprünglich komplett für die Grenzwachen vorgesehen. Die heutige Bohušovka-Siedlung wurde nach 1989 der Stadt übergeben, was für die Stadt wunderbar war, sie hat so hunderte Wohnungen bekommen. Ursprünglich waren das alles Wohnungen für die Grenzwachen. Die normalen Leute haben hier praktisch keine Wohnung bekommen. Über das hiesige Krankenhaus hatte man von Anfang an gesagt, dass sie es wie eines an der Front bauen. Wenn man es sich heute anschaut, sind die Operationssäle in der Mitte des Gebäudes platziert, damit man nur schwer in sie hineinschießen hätte können. Als eine private Firma das Krankenhaus übernommen hat, hatten sie mit diesen Räumen ein Problem. Der Kommunismus hat hier einfach viele Leute ernährt. Hier haben vor allem Offiziere mit ihren Familien gewohnt. Ein anderer Teil waren die Uranarbeiter. Nicht bei den Gräbern, aber bei den Technikern und höheren Arbeitern hat man ein gewisses Maß an politischem Bewusstsein verlangt. Aber das hatten wir schon in Leutensdorf so erlebt. Zum Beispiel in der Grube „Pluto“, wo es 1981 zu einem Grubenunglück mit 65 toten Bergmännern gekommen ist, besetzen Kader die verantwortungsvollen Positionen und die Leute, die wirklich etwas davon verstanden, wurden nach den Säuberungen auf weniger wichtige Arbeitsplätze versetzt. Der Kohlenstaub hätte dort mit Wasser bespritzt werden müssen und das wurde nicht so gemacht, wie man es hätte machen sollen.
Gab es bei den Arbeitern im Uranabbau eine Art Bergmannsleben? Mit Trachten, Bergparaden und ähnlichem? Man hat hier an die Erfahrungen aus Freiberg in Böhmen (Příbram) angeknüpft. Aber eher technisch als gesellschaftlich. An so etwas wie Vereinsleben kann ich mich nicht erinnern. Das begann erst nach 1990. Die damaligen Angestellten aus der Grube Tillenberg gründeten unter Leitung von Honza Teplík ein Bergbaumuseum. Das ist, denke ich, das Ergebnis davon, wie sie am Ende der Welt unter sich waren. Sie haben sich gefunden wie Seelenverwandte. Sie haben auch angefangen, an die Tradition des Silberbergbaus in Plan zu erinnern.
Haben Sie hier Deutsche getroffen, Alteingesessene? Und wie haben Sie die Region hier erkundet und kennengelernt? Deutsche gab es hier. Aber für mich war das nichts Außergewöhnliches. In Leutensdorf gab es noch weit mehr. Alte Frauen sprachen ein schlechtes Tschechisch. Ein paar Familien sind nach dem Krieg hiergeblieben. Die Region haben wir gern und mit Neugier erkundet. Wir hatten ein Auto und zwei kleine Töchter. Aber der Besuch von Pilsen (Plzeň) beispielsweise war ein Schock. Die Stadt war am Verfallen. Man sagte, dass der Staat Pilsen für die antikommunistischen Unruhen im Jahr 1953 bestrafen würde. Da wurde nicht eine Krone hineingesteckt. In den Dachrinnen wuchsen Birken. Mit Nordböhmen, wo sich um die Bergleute gekümmert wurde, lässt sich das überhaupt nicht vergleichen. Im Sozialismus kam das Geld in Nordböhmen aus den Gruben und der Industrie und ging teilweise auch dorthin zurück. Der öffentliche Raum war in Ordnung. Wenn wir heute dorthin fahren, ist das ein trostloser Anblick. Viel sind wir hier im Umland unterwegs gewesen. Uns hat das Amselbachtal so gefallen und mit dem Auto haben wir Ausflüge in Richtung Eger (Cheb) und Taus (Domažlice) gemacht. Wir sind gern durch Marienbad gelaufen. Uns hat es hier schnell gefallen.
Wie hat ihren Töchtern die Schule gefallen? Sie hat ihnen gefallen. Es gab eine Art doppelte Erziehung. Die Mädchen wussten, was sie zu Hause sagen durften und was in der Schule. Sie haben Freunde gefunden und interessante Freizeittätigkeiten. Durch ihren Lehrer Herrn Martínek gingen sie in den Naturwissenschaftszirkel und sie gingen auch in die Musikschule. Je älter die Töchter wurden, desto zufriedener waren sie hier, weil wenn wir nach Leutensdorf oder Brüx (Most) gefahren sind, hat man gesehen, wie dort alles verfallen ist.
Wie war es in dieser Zeit ein Haus zu bauen? Furchtbar. Furchtbar. Unser Haus wurde zum Glück aus Hälften zusammengebaut. Wir haben quasi einen Baukasten gekauft, der wurde uns zum Bahnhof geliefert. Das erste Problem war einen Laster zu kriegen. Wir hatten zwei Tage zum Abladen. Dann war es eine Kunst, Baumaterial zu bekommen. Wir hatten Bekannte in Kommern (Komořany) bei Brüx, wo aus der Flugasche der Kraftwerke Baumaterial hergestellt wurde. Formsteine und so. Wir haben uns auch einen Wagon bringen lassen. Gegenüber hat ein Mann gewohnt, der beim Kreisbaubetrieb Fahrer war. Das war ein großes Glück. Er hat uns in seiner Freizeit bei den Bauarbeiten geholfen. Da wir damals in Eigenhilfe gebaut haben, bekamen wir ein Einkaufsbuch, in dem geschrieben stand, worauf wir Anspruch hatten. Auf zwei Waschbecken, zwei Toiletten, Wasserhähne, sieben Meter Fliesen und so weiter. Nur bekam man die Sachen nirgendwo. Franta ist durch den Bezirk gefahren, er wusste, was wir brauchen. Er kam vorbei und sagte: „Ich habe Fliesen für euch“. Wir wussten, dass es keine Auswahl gab. Wir müssen nehmen, was es gab. Zu der Zeit gab es blaue Fliesen, mit Blasen als Verzierung. Den Bau haben wir 1976 begonnen. Die Wände waren fast fertig, aber es fehlten uns fünf Säcke Zement. Es gab keinen. Der Weiterbau hat sich um einen Winter verzögert. Wir haben hier selbstverständlich selbst geschuftet, in unserer ganzen Freizeit. Mein Mann stand ziemlich unter Druck. Am Schacht verliefen gerade die größten Investitionsmaßnahmen überhaupt. Er musste manchmal auch samstags und sonntags gehen. Sie haben sich dann dagegen aufgelehnt und die Grube besetzt. Die Abmessungen mussten millimetergenau stimmen, bis auf Tausend Meter Tiefe sollten Förderkäfige fahren. Es geschah auch, dass wir Zement fertig gemischt hatten und mein Mann dann wegfahren musste. Ich habe für die Maurer gekocht, das hat man damals so gemacht, anders ging das nicht. Zu der Zeit war Fleisch zu kaufen ein Gräuel und die Mauerer wollten natürlich nichts anderes. Eine Freundin gab den Kindern eines Fleischers aus dem Ort Nachhilfe. Im Laden gab es nichts, aber sie konnte uns Fleisch besorgen. Keinen Lendenbraten, einfaches Fleisch für Gulasch. Wenn mein Mann wegfahren musste, war es an mir zu kochen und die Handwerker auf dem Bau zu versorgen. Das war wirklich eine Schinderei.
Damals wurde viel gestohlen. Gab es bei Ihnen auch solche Vorfälle? Das würde eher mein Mann so sagen. Ich erinnere mich, wie er einmal sagte, dass er ausgesondertes Holz aus den Schächten gekauft hätte, es ihm aber gestohlen worden war. Das hat er bedauert, weil das Holz imprägniert war, es wäre also nicht verfault.
Wie lange hat der Bau gedauert? Wir haben 1976 angefangen. Eingezogen sind wir im November 1978. Unsere Nachmieter waren ganz versessen auf unsere Wohnung, deswegen haben sie uns beim Umziehen geholfen. Ich war im Haus und sie haben unsere Sachen gefahren. Ich wollte dann die Wohnung aufräumen, aus der wir ausgezogen waren und habe festgestellt, dass sie ihre Möbel schon hingebracht hatten. Dann habe ich lediglich die Bratpfanne mit Fleisch aus dem Ofen genommen und schon waren wir umgezogen. Das war damals ein Winter, in dem 29 Grad unter Null herrschten. Zum ersten Silvester haben wir dann Freunde zu einer Feier eingeladen. Die Einfahrt war noch nicht fertig, dort war noch weicher Boden. Als die Freunde am nächsten Tag früh wegfahren wollten, haben sie riesige, gefrorene Erdbatzen herausgeschleudert, da sich das Auto vorher festgefahren hatte. Wegen des Frosts ist der Strom ausgefallen. Wir saßen in der Patsche, weil wir hier weit und breit die Einzigen mit einem Gaskessel waren. Das bedeutete, dass er mit Strom angezündet werden musste. Mein Mann fuhr am fünften Januar zum Erholungsaufenthalt in die Nähe von Kaschau (Košice), wohin die Uranarbeiter hin und wieder fahren mussten. Ich bin mit unserer Tochter alleine geblieben. Wir hatten uns entschieden, uns einen Ofen als Ersatz für ähnliche Situationen zuzulegen. Ich habe mir auf Arbeit Geld dafür geborgt, wir hatten keines mehr. So haben wir bei dem Frost ein Loch in den Schornstein gehackt. Ein Nachbar ist vorbeigekommen und hat gesehen, dass mein Mann das Loch hackt. Dann hat er angeboten zu helfen, hat zugeschlagen, vom Meißel flog ein Stück Krätze ab und schlitzte ihm direkt die Schlagader auf. In meiner Schürze, so wie ich war, habe ich ihm dann die Ader abgedrückt, mein Mann saß in unserem Trabant am Steuer, wir sind ins Krankenhaus gefahren. Unsere dreijährige Tochter rief zur Frau des Nachbarn, die bei uns schnell auf die Kinder aufpasste: „Frau Havlová, Herr Havel stirbt wahrscheinlich, oder?“
Wie sind sie zu Ihrem Trabant gekommen? Musste man auf ihn genauso lange warten wir auf einen Škoda?
Mein Mann ist in die Slowakei gefahren, um ihn zu holen. Dort bekam man die problemlos. Danach hatten wir einen Moskwitsch. Die waren auch eine Zeit lang leicht zu kriegen. Ohne Warteliste. Das war dem Trabant gegenüber ein riesiger Unterschied. Der Moskwitsch hat geheizt.
Wie war es hier in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts? War es zu spüren, dass sich die Verhältnisse langsam lockerten?
Hier nicht so sehr. Hier lebten sehr parteitreue Menschen. Besonders in den Schulen, in denen ich mich viel aufgehalten habe. Die Schule, das war immer eine ideologische Basis. Aber die Löhne im Uran waren hoch, deswegen ging es einem Teil der Leute recht gut.
In den Westen durften Sie wahrscheinlich nicht reisen. Sind sie in die „sozialistischen Brüderländer“ gefahren? Für jemanden, der im Uran gearbeitet hat, war eine Reise in den Westen selbstverständlich ausgeschlossen. Aber wir sind öfters nach Ostdeutschland gefahren. Mein Schwiegervater hat 1968 bei einem Erholungsurlaub in Ungarn eine Ostdeutsche aus Pirna bei Dresden kennengelernt. Er war Witwer. Sie durfte nach 1968 noch einige Jahre nicht hierher kommen, trotzdem haben sie geheiratet. Sie musste auswandern und wurde Staatsbürgerin der Tschechoslowakei. Wir sind viel zu ihnen gefahren. Natürlich auch nach Dresden, um den Kindern Strumpfhosen zu kaufen oder auf einem Schiff auf der Elbe entlang zu fahren.
Welche Erinnerungen haben Sie an Zollbeamte? Furchtbare! Einmal hatten wir Sachen für die Kinder und eine Tischlampe gekauft. Wir sind dann absichtlich über den kleineren Grenzübergang gefahren. Der deutsche Zollbeamte hat uns gefragt, was wir dabei hätten und wir haben gesagt, dass wir eine Lampe hätten. „Und was noch?“. „Kinderschuhe“. „Zeigen Sie mal“. Sie haben uns das ganze Auto auf so eine Bank ausladen und dann wieder einladen lassen. Sie haben uns nichts weggenommen und uns auch nichts getan. Sie haben uns nur unserer Zeit beraubt und gezeigt, was sie alles können. Oder als wir unseren Farbfernseher gekauft hatten und dann nach Plauen gefahren sind, um einen Verstärker zu besorgen. Den haben wir dann in die Zollerklärung eingetragen. Der hatte ungefähr 260 Mark gekostet. „Nach dem Gesetz der DDR ist es verboten, den Verstärker auszuführen.“ Wir durften fahren, aber sie haben uns ein Papier gegeben, das besagte, dass wir ihn innerhalb von zwei Tagen zurückgeben mussten. Am zweiten Tag gab es furchtbares Glatteis. Mein Mann war losgefahren um den Verstärker zurückzubringen. Ich habe mir Sorgen um ihn gemacht. Wir waren mit den Gedanken dann immer an der Grenze. Von den Sachen, die wir brauchten, haben wir den Großteil durchgebracht. Einen Teil der Sachen haben wir auf die Zollerklärung geschrieben, den Rest nicht.
Von Plan aus hätte der Sozialismus also noch dreißig Jahre länger dauern können? Das kann man so nicht sagen. Im Vergleich zum bergmännischen Leutensdorf war die hiesige Versorgung miserabel. Genügend Leute haben sich ihren Teil gedacht, aber nur im Privaten. Ich muss zugeben, dass ich mir gesagt habe, als meine Tochter Jana sich zum Medizinstudium angemeldet hat, dass ich auch in die KSČ eintreten würde, damit meine Tochter, die so fleißig gelernt hatte, einen Studienplatz bekommen würde. Zum Glück ist dann die Revolution gekommen. Ich habe gesehen, wie man in der Schule komplexe Bewertungen über die Kinder schrieb. Die politische Bewertung hat eine große Rolle gespielt. Auch wenn nicht überall gleich. Wenn ein Elternteil von einem Kind aus einer für den Kader „schlechten“ Familie Arzt war, war die Bewertung nicht so schlecht, weil es ratsam ist sich mit Doktoren gut zu stellen. Aber ich habe gesehen, dass es eine Menge Kinder gab, die es aus politischen Gründen nicht an die Universität geschafft haben.
Auf dem Marktplatz in Plan steht ein großes Kaufhaus aus kommunistischen Zeiten. Es heißt Hraničář. Dafür sind damals die Häuser im Renaissance-Stil abgerissen worden…
An die Häuser im Renaissance-Stil erinnere ich mich nicht, weil dort schon Trümmer lagen, als wir hergezogen sind. Das Kaufhaus hatten sie 1981 eröffnet. Aus Plan ist mit einem Schlag ein zu einem regelrechten Dorf geworden. Das sozialistische Handelsunternehmen „Jednota“ („Einheit“) hat alle seine Betriebsstätten in das Kaufhaus verlegt. Sie haben praktisch alle Läden am Marktplatz zugemacht. Damit das nicht so schlecht aussah, haben sie Werbeposter in die Schaufenster gehängt. Dann haben sie festgestellt, dass es so nicht geht und haben zum Beispiel ein Schuhgeschäft zurückverlagert. Aber erst nach 1990 wurden die Läden wieder erneuert. Heute sind die Häuser am Marktplatz privat und die Läden schließen oft, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können.
Sie waren bei den Anfängen des hiesigen Bürgerforums dabei. Wie verlief die Revolution in einer Stadt, die im Grenzgebiet liegt? Das begann damit, dass bei uns in der Schule einer der hiesigen Einwohner, der Projektant Petr Orel, auftauchte. Er war damals, glaube ich, noch Student. Wir wussten aus dem deutschen Fernsehen, dass bei uns etwas vorging. Petr Orel kam mit studentischen Flugblättern ins Büro der Schule, deswegen habe ich ihn als Erste gesehen. Er wollte zum Direktor, der hat ihn aber rausgeschmissen. Die Kommunisten hatten sich hier und da versammelt und gesagt, dass ihnen das hier niemand zerstört. Wir, die wir unsere Meinungen untereinander kannten, haben aber auch begonnen, uns zu organisieren. Anfang Dezember hatten wir das Bürgerforum gegründet. Das Rathaus hat uns in den Sitzungsraum gelassen, der buchstäblich vollgestopft war. Auch in Plan begann das Eis zu brechen. Zuerst hat das Bürgerforum die parlamentarischen und dann die lokalen Wahlen haushoch gewonnen. Im Herbst 1990 wurde Herr Kalaš Bürgermeister. Es wurde ein komplett neuer Stadtrat gebildet. Und ich wurde Sekretärin der Stadtverwaltung. In der Schule habe ich gekündigt.
Wer war Herr Kalaš? Er war eine im Sozialismus unerwünschte Person. Die Familie ging zur Kirche, das wussten alle. Seine Frau ist Ärztin, er war Laborleiter im Krankenhaus. Die Leute haben ihn als Bürgermeister akzeptiert, weil sie von ihm wussten, dass er sich von den anderen unterscheidet. Es enstand hier nach der Revolution eine Gruppe von Leuten, die sich einfach gefunden hatten. Leute ohne Vergangenheit in der KSČ.
Wie war das dann auf dem Rathaus? Von euch wusste ja niemand, wie man eine Stadt zu leiten hatte, oder? Es war unterhaltsam. Wir haben unsere Posten auf dem Rathaus mit blitzsauberen Schubladen und Schränken angetreten. Es gab ganz neue Gesetze. Im vorherigen System gab es Bezirksämter. Der Haushalt und alles weitere wurde auf dieser Ebene bewilligt. Auf einmal mussten wir alles selbst machen. Wir haben Schulungen besucht und natürlich haben wir auch Fehler gemacht. Ich habe für alle Angestellten neue Personalakten angelegt. Die Zahl der Leute wurde größer, vor der Revolution waren auf dem Amt, das ja damals nichts entschied, nur ein paar Mitarbeiter angestellt. Wir haben auch neue Abteilungen eingerichtet, zum Beispiel Umwelt und Eigentum. Wir haben Leute gesucht und angestellt. Ich würde sagen, dass es so zwei Jahre gedauert hat, bis sich das Amt stabilisiert hat. Ein Glücksfall war, dass hier Betriebe geschlossen worden sind, in denen erfahrene Leute in der Administration gearbeitet hatten. Dadurch konnten wir uns Leute aussuchen. Von den Frauen haben wir zum Beispiel vor allem diejenigen genommen, die Kinder hatten, die wenigstens schon im Kindergarten waren. Zwanzig Jahre lang gab es keine Probleme, es sind kaum Leute weggegangen. Wir haben auch städtische Firmen geschaffen. Zuerst Körperschaften für das öffentliche Interesse, dann Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Im Sozialismus gab es hier nur eine Putzfirma. Wir haben die Plánské služby (Planáer Dienstleistungen) gegründet, sich sich zum Beispiel um Wohnungen gekümmert hat. Die Stadt hat die Wälder zurückbekommen, also haben wir Plánské lesy (Planáer Wälder) gegründet. Wir haben die optimalen Formen für die Organisation gesucht.
Was waren die ersten Kontakte nach Bayern und wie entstand die Partnerschaft mit Tirschenreuth? Karel Martínek, der an der Grundschule am Markt Naturkunde unterrichtete, arbeitete schon vor 1989 für den Naturschutz. Dort hatten sich einige Leute mit anderen Meinungen gefunden. Der Naturschutz aus Tännesberg hatte Kontakt zu ihnen aufgenommen. Daraus hat sich eine Partnerschaft entwickelt. Wir sind dorthin gefahren, sie hierher. Wir haben gelernt, was die Bürgergesellschaft für den Naturschutz macht. Dann gab es hier verschiedene Vereine, die auch Kontakte geknüpft hatten, Sportler, die Feuerwehr, Frauen, Rollstuhlfahrer. Die Pilgerwanderung zur heiligen Anna wurde wiederbelebt. Es war von Vorteil, dass Herr Kalaš gläubig ist, er kannte Leute aus Kirchenkreisen. Nach und nach entstand ein Netzwerk an Kontakten, was dann bis zur Städtepartnerschaft mit Tirschenreuth heranwuchs. Zu Beginn ging die Initiative aber immer von der deutschen Seite aus. Aber die Stadt half, wenn sie konnte. Wir wollten eine Bürgergesellschaft formen.
Denken Sie, dass es Ihnen gelungen ist, eine Bürgergesellschaft zu schaffen? Es war eine Zeit, zu der wir das Gefühl hatten, dass es gut läuft. Jetzt haben wir weniger Zeit. Die Akteure von 1989 sind nicht mehr aktiv. Das heutige Problem liegt darin, dass die jungen Leute weggegangen sind. Alle meine Bekannten, die Kinder haben, Mittelschüler und Hochschüler, haben ihre Kinder anderswo. Sie sind weggezogen, hier gibt es keine Arbeit für sie. Und das sollten eigentlich die Träger der Kultur und der Bürgergesellschaft sein. Viele Junge sind im Ausland. Auch in Amerika. Sie haben die Möglichkeit eines Studienaufenthaltes genutzt und sind dort geblieben. Die gegenwärtige Bürgermeisterin Martina Němečková ist das leuchtende Beispiel eines Kindes, das in Plan geblieben ist. In Plan gibt es viele interessante Veranstaltungen, die zum Beispiel die Bibliothek organisiert. Aber kaum jemand nimmt daran teil. Im Jahr 1990 haben wir uns vorgestellt, dass der Elan und die Begeisterung länger anhält. Es fehlt an aktiven Leuten. Arbeit gibt es bei uns in der Region schon, aber nicht für Fachpersonal.
Haben Sie das Vertrauen der Leute für die Stadtverwaltung gewinnen können? Hat es sich in den Jahren, in denen Sie Sekretärin waren, irgendwie verändert? Hatten Sie das Gefühl, dass die Leute Sie als jemanden annehmen, den sie wirklich gewählt haben? Wir haben recht lange das Gefühl gehabt, dass uns die Leute annehmen. Ich spreche in der Mehrzahl, weil ich glaube, dass das so war. Die Leute haben gewusst, mit wem sie verhandeln – wir haben uns bemüht, entgegenkommend und anständig zu sein. Es gibt natürlich Leute, die in jedem Regime unzufrieden sind. Ewig unzufrieden.
Was blieb von Ihnen als erste frei gewählte Repräsentanz übrig? In den ersten vier Jahren ging es erst einmal darum, sich zurechtzufinden. Es fehlten Gesetze, wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was wir genau wollen. Der Herr Bürgermeister Tomášek hat ein strenges Auge auf die Finanzen gehabt. Er hat Geld gespart. Wir haben mit Wasser und der Kanalisation angefangen. Die Wasserleitungen wurden komplett neu gemacht. Schon vor 1989 war das Projekt, die Kanalisation im nördlichen Teil der Stadt auszubauen, abgeschlossen worden. Mein Mann schlug eine Abänderung des Projekts mit Nutzung der alten Bergbauschächte vor. Das war eine bedeutende Veränderung, da die Kanalisation so nicht durch den Sumpf des Auenwaldes führen musste und man den größeren Höhenunterschied ausnutzen konnte.
Die Kanalisation wurde in die neue Kläranlage geführt. Das Projekt, das unser Rathaus vorschlug, war umweltfreundlicher und billiger. Damit wurde auch die Renovierung des Wehrs vom Stadtteich verbunden. Wir haben einige Häuser, die sich noch im Bau befanden, fertiggestellt und die Pflege der städtischen Wälder ist auch gut angelaufen. Subventionen haben wir viel genutzt. Wir haben die St. Peter und Paul-Kirche renoviert. Das ist eine romanische Kirche, bei der das Tor herausgebrochen war und die jahrelang als Scheune genutzt wurde. Aber es waren nicht nur Investitionsmaßnahmen. Ich glaube, dass die Erneuerung der deutsch-tschechischen Pilgerwanderung zur heiligen Anna auch etwas ist, was zu unserer Zeit anfing und geblieben ist. Unser Raum zum Leben ist größer geworden. Das schließt auch die Tatsache mit ein, dass Leute aus Plan nach Bayern zum Arbeiten fahren. In den neunziger Jahren liefen auf der bayerischen Seite die Porzellanbetriebe und andere Firmen noch gut, die mittlerweile geschlossen haben. Damals, nach der Revolution, sind ganze Busse zum Arbeiten nach Bayern gefahren. Das ist heute nicht mehr so. Die Städtepartnerschaft mit Tirschenreuth läuft auch und überdacht quasi die Aktivitäten der Vereine. Wenn ich insgesamt so zurückblicke, glaube ich, dass zu unserer Zeit alles entstanden ist, was sich heute noch weiterentwickelt. Ich bin froh, dass ich dabei gewesen bin.
Fühlen Sie sich hier zuhause? Ja. Gewiss. Ich mag den Marktplatz, den Stadtpark, der jetzt in Ordnung ist, wir haben hier viele gepflegte Gärten, ein Stück Wald, wir sind leidenschaftliche Pilzsammler. Unsere Kinder sind hier aufgewachsen. Einundzwanzig Jahre auf dem Rathaus bedeutete für mich ständig darüber nachzudenken, was man hier noch verbessern kann. Ich habe schon lange vergessen, dass wir mal woanders zuhause waren.