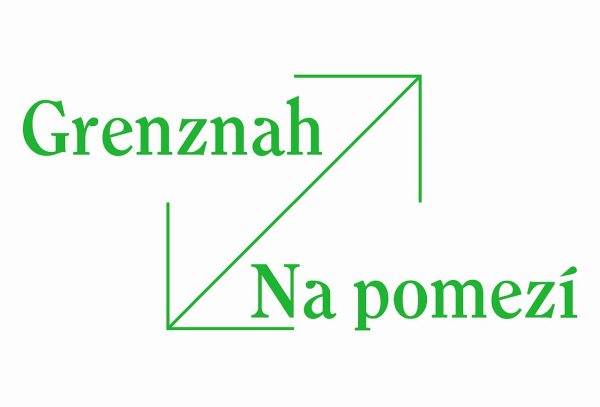Seit den sechziger Jahren haben sich die Verhältnisse in Plan verbessert
Gespräch mit Michaela Vrzalová
Frau Vrzalová, die meisten Interviews beginne ich mit der Frage: „Wie sind Sie nach Plan gekommen?“ Sie sind hier geboren. Wie war das, am Ende der Welt, in unmittelbarer Nähe zum Eisernen Vorhang, in der kalten Grenzregion aufzuwachsen?
Als ich klein war, habe ich das hier weder als Ende der Welt betrachtet, noch den Eisernen Vorhang wahrgenommen. Ich bin eben hier geboren und aufgewachsen. Aber es stimmt, dass es eine Zeit gab, in der ich nicht hier leben wollte. Ich wollte in Prag (Praha) leben. Meine Großmutter und mein Großvater sind nach Prag gezogen, zu ihrer Tochter, um ihr mit ihrem Kind zu helfen. Wir sind oft dorthin gefahren, ich mochte Prag und fand die Stadt toll. Dann habe ich dort studiert, im Studentenwohnheim gewohnt und alles genossen, was die Stadt zu bieten hatte. Ich wollte nicht unbedingt zurück. Aber in Prag eine Wohnung zu bekommen war nicht einfach. Außerdem wollte mein späterer Mann, mit dem ich damals schon zusammen war und die Hochzeit plante, nicht in Prag bleiben. Wir sind nach Plan (Planá) zurückgekehrt. Heute bin ich hier wirklich zufrieden, in dieser kleineren Stadt. Ich habe Freunde und Bekannte hier, Prag kommt mir heute viel zu anonym vor. Ich besuche dort regelmäßig Verwandte, aber zuhause bin ich hier.
Ihr Mann ist also an Ihrer Rückkehr schuld. Stammt er aus Plan?
Ja, aus diesem Haus.
Was hat diese schöne Villa in ruhiger Planer Lage für eine Geschichte?
Das Haus wurde Ende der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts von Deutschen gebaut. Die Eltern meines Mannes kamen 1947 hierher. Mein Schwiegervater hatte eine Stelle als Oberarzt der Inneren Medizin im Planer Krankenhaus bekommen. Sie waren nach der Vertreibung der Deutschen ungefähr die siebten, die in das Haus kamen. Von der Ausstattung war nichts mehr übrig, die Abenteurer, die hier durchgezogen waren, hatten alles mitgenommen. Als wir aus Prag zurück kamen, haben die Eltern oben gelebt und wir unten. Heute lebt mein Schwager oben.
Können Sie sich an Erzählungen von ihrem Mann oder ihren Schwiegereltern über die Ankunft in Plan erinnern? Wie weit reicht das Familiengedächtnis zurück? Ich kenne hauptsächlich die Erzählungen meiner Mutter, Großmutter und meines Großvaters. Mein Vater war Arzt, Chirurg, er hatte 1952 eine Arbeitsplatzzuweisung in Plan bekommen. 1953 hat er meine Mutter geheiratet, sie ist ihm nach Plan gefolgt. Noch im gleichen Jahr sind auch die Eltern meiner Mutter aus Taus (Domažlice) zu ihnen gezogen. Mein Großvater war seit 1938 Bezirkshauptman in Taus gewesen, außer in den Kriegsjahren (er war im Konzentrationslager). Nach der Machtübernahme der Kommunisten 1948 hatte er seinen Posten verloren und plötzlich fand er sich im Ruhestand wieder. Politisch war es damals schlimm für ihn, die Staatssicherheit hat ihn verhört. Er ist dann nach Plan gegangen, um seine Ruhe zu haben. Mein Großvater war Jurist und hat sich für Geschichte interessiert. In Taus, wo er fünfzehn Jahre lang gelebt hatte, hatte er sich mit Volkskunde beschäftigt. Als er hierher kam, begann er sich für die Geschichte des Ortes zu interessieren. Er konnte hervorragend Deutsch und auch Schwabacher Schrift lesen. Der damalige Bezirksausschuss bat ihn, ihnen beim Zusammenstellen des Archivs zu helfen. Dort ist er auf viele interessante Sachen gestoßen, hat verschiedene Literatur entdeckt. Er hat für Zeitungen über die Geschichte der Region Plan geschrieben. Hier waren praktisch alle Zugezogene, über die regionale Geschichte wussten sie gar nichts. Mein Großvater hat dann das Planer Museum neu gegründet. Das Umfeld hier war dafür günstig. Dank des Gymnasiums, des Krankenhauses mit den Ärzten und dem Gesundheitspersonals, lebten hier viele gebildete Leute. Sie hatten Niveau und waren umgänglich, so habe ich das in Erinnerung.
Hat sich dieses Niveau dann verbessert oder verschlechtert? Im Schloss eine Kaserne, der Abriss historischer Häuser, die Schließung des Gymnasiums…
In den 50er Jahren gab es einige Häuser, die nicht bewohnt waren und einstürzten. In der Stadt entstanden Baulücken, das ist wahr. In den sechziger Jahren haben sich die Verhältnisse in Plan meiner Ansicht nach aber schon verbessert. Nach 1989 war die Verbesserung wirklich beachtlich. Der neu gestaltete Marktplatz zum Beispiel gefällt mir wirklich gut und ich bin froh, dass mein Mann, noch bevor er Bürgermeister wurde, die Fußgängerzone durchgesetzt hat. Zu seiner Zeit wurde die Kirche St. Peter und Paul renoviert und das Freibad instandgesetzt.
Wurde unter den Kindern und jungen Leuten über die nahe, verdrahtete Grenze gesprochen?
Als Heranwachsende haben wir uns darüber unterhalten, dass an der Grenze Drähte sind, und dass man dort nicht hin darf. Später waren wir einmal Richtung Braunau (Broumov) im Wald unterwegs und dann hieß es, dass wir da nicht weiter können. Ich bin mit dieser Situation aufgewachsen, deshalb kannte ich es nicht anders, es war eben so. Erst in den siebziger Jahren ist mir richtig bewusst geworden, was da los war. Auch das Deutschland hinter der Grenze hat mich mehr interessiert. Ich wollte dort einfach mal hin.
Wir sehen uns ab und zu in der Kirche. Wie sah es in der Zeit des Sozialismus mit der Religion aus?
Diese Gegend hier ist sehr atheistisch. In die Kirche ist nur mein Großvater gegangen, der Rest der Familie konnte sich das nicht erlauben. Meine Mutter war Lehrerin. Sie hätten vielleicht schon so etwas wie Helden sein müssen, um damals den Gottesdienst zu besuchen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in Prag in die Kirche gegangen sind, wenn wir dort zu Besuch waren. Mein Großvater hat mich manchmal auch hier in Plan mit in die Kirche genommen. Das hat sich dann bis in die Schule herumgesprochen und sie haben meine Mutter vorgeladen. In einer kleinen Stadt kennt eben jeder jeden.
Wie sah das Jahr 1968 in Plan aus? Das war ein Schock, genauso wie in anderen Orten auch. Die Russen sind gekommen, haben sich mit Panzern und gepanzerten Autos hinter dem Freibad im Wald versteckt. Ich erinnere mich noch, wie uns Bekannte anriefen. Wir haben uns getroffen, die Nachbarn, unter ihnen waren auch Kommunisten und ein Offizier. Wir haben vor dem Haus diskutiert und alle bis auf eine Frau waren gegen die Okkupation. Es wurden Plakate geschrieben, die Straßenschilder übermalt. Das war im Sommer, wir hatten über die Ferien meine Großmutter aus Prag mit ihrem kleinen Enkel zu Besuch. Ich habe ihn gern im Kinderwagen herumgeschoben. Mit einer Freundin sind wir einmal mit dem Kinderwagen in den Wald zu den Russen gegangen. Wir wollten ihnen sagen, dass sie nach Hause fahren sollen. Zum Glück haben wir Angst bekommen, als wir näher kamen und sind nach Hause gerannt.
Mit welchen Vorstellungen haben Sie Ihr Jurastudium begonnen? Aus Familientradition? Für die Gerechtigkeit?
Ich habe nicht genau gewusst, was ich studieren soll. Ich war immer eher humanwissenschaftlich orientiert. Da war ein bisschen Familientradition dabei und außerdem habe ich mir gesagt, dass das ein allgemeinbildendes Studium ist. Ich kann Rechtsanwältin werden, in ein Unternehmen gehen, ich schaue mich um und suche mir aus, was mir gefallen könnte.
Später kam aber auch die Gerechtigkeit ins Spiel?
Eine Zeit lang wollte ich Anwältin sein. Dann bin ich zum Gericht gekommen. Ich wollte nicht in der strafrechtlichen Abteilung des Gerichts arbeiten, weil ich wusste, dass dort politische Sachen auftauchen könnten. Ich wollte Richterin für Zivilrecht sein, mich um Streitsachen im Arbeitsrecht, Vermögensrecht oder Familienrecht kümmern. Am Gericht sollte es um Gerechtigkeit gehen. Im Zivilrecht geht es aber vor allem darum, wer was beweisen kann. Ich habe meine Arbeit gerne gemacht. Zum Ende hin hat es mir aber weniger Spaß gemacht, als sich die Fälle häufig um nicht bezahlte Kredite, Schulden für Strom usw. drehten. Ich mochte Geschichten, auch am Gericht, und mein ganzes Leben habe ich mich für Geschichte interessiert.
Wie äußerte sich in ihrem Arbeitsbereich der Regimewechsel?
Es trat ein neues Bürgerliches Gesetzbuch in Kraft und viele Rechtsvorschriften änderten sich, Heute ist das so unübersichtlich, dass wenn es keine Computerprogramme gäbe, die das für einen aussortieren, würden sich darin viele nicht mehr auskennen. Nach der Wende musste ich viel dazulernen.
Kommen wir noch einmal zu Ihrem Großvater und Ihrem Interesse an Geschichte zurück – wie haben Sie die Geschichte Ihrer Heimat aufgedeckt?
Für meinen Großvater war es interessant, dass die Menschen, die hier lebten, überhaupt nichts wussten. Genau wie er waren sie von anderswoher gekommen. Sie konnten bei null anfangen. Alle stammten aus Orten, wo die Menschen über ihre Gegend alles Mögliche wussten. Mein Großvater hat eine Broschüre verfasst, die „Die Chodenplaner“ heißt. Es gab Enthusiasten, die nach dem Krieg die tschechischen, chodischen Wurzeln hier in der Gegend suchten. Sie wiesen nach, dass die ursprüngliche Bevölkerung hier slawisch war. Vielleich sind einige Ansichten darin heute überholt, aber es liest sich gut. Ich habe meinen Großvater oft im Museum besucht und weiß bis heute, was es dort alles gab. Mein Großvater hatte die Unterlagen für das Museum aus dem Archiv des Nationalausschlusses. Das Museum hat er in dem Haus gegründet, wo sich heute die Bibliothek befindet, im Erdgeschoss. Die Exponate waren vom Eingang her aufgereiht, dort, wo heute die Stadtinformation ist. Es begann mit der Vorgeschichte und Ausgrabungsstücken. Ich erinnere mich an Faustkeile. Dann ging es weiter mit dem romanischen Stil, über den Barock. Erst ganz am Ende waren Exponate zur Gegenwart, also die sogenannten Errungenschaften des Sozialismus. Ich glaube, dass die Exponate, die ich kannte, aus dem früheren Museum in Plan stammten, das an der anderen Seite des Marktplatzes in der ehemaligen Münzwerkstatt gewesen ist. Mein Großvater hat diese Sachen wahrscheinlich mit Hilfe weiterer Personen geordnet. Das Museum war seit 1959 in Betrieb, mein Großvater hat es geleitet. Oben hatte er sein Büro und wenn jemand geklingelt hat, ist er nach unten gegangen und hat ihn durch das Museum geführt. Als Kind hat mir ein Bild gefallen, auf dem ein Junge abgebildet war, der eine Uhr in der Hand hatte und Brei auf sie gegossen hat. Interessant waren auch die Petrusfigur und die Madonna. Sie stammten aus der Planer Kirche St. Peter und Paul, die schon von Kaiser Josef II. aufgelöst worden war. Ich erinnere mich noch, wie wir den heiligen Peter mit unserem Auto zu einer Restaurateurin in Prag gebracht haben. Dann gab es dort auch ein sehr schönes, mit Stickereien versehenes Ornat, das heute im Museum in Tachau (Tachov) ausgestellt ist. 1965 sind die Exponate ins Tachauer Museum gebracht worden. Alles, was ging, wurde nach Tachau geschafft, das nach der Territorialreform 1960 unsere neue Bezirkshauptstadt wurde. Mir kam es so vor, als wollten sie dort einfach alles haben.
Einschließlich des Gymnasiums..
Das Gymnasium gab es hier schon vor dem Krieg. Das staatliche Realgymnasium, das 1947 erneuert wurde. Es wurde auch von Schülern aus Tachau und Marienbad (Mariánské Lázně) besucht, keine dieser Städte hatte zu der Zeit ein Gymnasium. Als dann in beiden Orten Gymnasien entstanden waren es wahrscheinlich zu viele. Ich habe noch in Plan Abitur gemacht. Mir tat das damals leid. In Tachau gab es noch nicht mal ein Gebäude, es wurde im Pionierhaus und in Klassenräumen der Grundschule unterrichtet. Sie hatten nicht die Räumlichkeiten dafür, und trotzdem wurde das Planer Gymnasium geschlossen und alle mussten nach Tachau fahren. Das letzte Abitur in Plan wurde im Jahr 1974 abgelegt. Alle drei Jahre findet ein Treffen der Abiturienten statt, die nach dem Krieg in Plan ihr Abitur gemacht haben. Seit dem ersten Jahrgang, der 1950 sein Abitur ablegte. Das sind immer sehr schöne Treffen.
Sie haben Interviews mit Zeitzeugen geführt. Hat Sie irgendeine Geschichte besonders bewegt oder fanden Sie Gemeinsamkeiten?
Wir haben zusammen mit meiner Mutter Menschen gesucht, die schon vor dem Krieg hier lebten. Alle erzählten von einem schönen Leben in einer überwiegend landwirtschaftlich geprägten Stadt. Handwerker, kleine Geschäfte, Feierlichkeiten. Sie haben viel über die Wallfahrt an St. Anna gesprochen.
Wie haben Sie die sechzehnjährige Amtszeit Ihres Mannes als Bürgermeister erlebt?
Zu Beginn hatte ich einige Bedenken, auch wenn die Bedingungen ein bisschen besser waren als 1990–1991. Ich wusste, dass das viel Arbeit wird, auch für mich, was sich bewahrheitet hat. Er hat mich als Juristin ziemlich beschäftigt. Er hat eine technisches Denkweise, wenn etwa nicht genau nach dem Gesetz ging, habe ich das abbekommen: „Ihr Juristen, was denkt ihr euch da wieder aus?“. Dann habe ich festgestellt, dass ihm diese Arbeit wirklich liegt.
Tirschenreuth hat als Symbol der Stadt einen Karpfen. Was könnte für Plan stehen?
Die heilige Anna. Den Bohušův-Hügel. Der Taler aus der Münzwerkstatt der Schlicks ist sicher auch ein gutes Symbol für die Stadt.