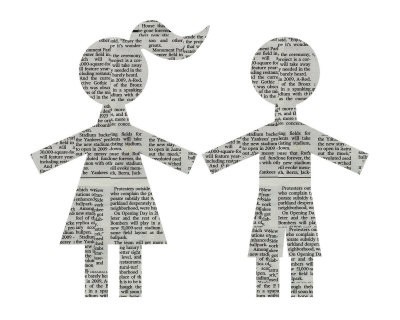Rettet das „-ová“!
Ich habe das “-ová”, jene Nachsilbe, welche die weibliche Variante eines Familiennamens kennzeichnet, von Anfang an geliebt.
Es tat meiner Liebe keinen Abbruch, als ich bei meinen ersten Versuchen, tschechische Zeitungen zu lesen, entdeckte, dass auch ausländische Namen nicht verschont bleiben – ganz im Gegenteil. Manchmal blätterte ich in meinem Adressbuch, gab in Gedanken allen weiblichen Personen, die ich im Lauf der Zeit eingetragen hatte, ein “-ová” und freute mich über den exotischen Effekt. Auch hatte ich viel Vergnügen mit Hana Hegerovás Hommage an Mae West “Táta měl rád Maju Westovou” und dachte über das Schicksal weltweit berühmter Frauen mit schwer kompatiblen Namen nach. Ob beispielsweise Yoko Ono im Tschechischen “Onoová” hieß? Oder doch nur “Onová”? Das Vergnügen an derlei Spekulationen endete jäh, als ich in einer Grammatiklektion auf den Hinweis stieß, dass es sich bei weiblichen Nachnamen um Possessivadjektive handle und somit eine Frau Müllerová das Eigentum von Herrn Müller sei. Ich dachte augenblicklich an Brüsseler “gender mainstreaming”-Kommissionen, die im Geheimen an einer Zwangsreform der tschechischen Sprache arbeiten, von der Václav Klaus bereits Wind bekommen hat. Er kann nur deswegen ein so vehementer EU-Gegner sein, so meine Mutmaßung, weil er möchte, dass seine Frau eine Klausová bleibt.
Doch neulich las ich in der Prager Zeitung, dass sogar tschechische Politiker in vorauseilendem Gehorsam daran arbeiten, das “-ová” aus der Sprache zu tilgen, da es den Grundsätzen der Gleichberechtigung widerspreche und daher nicht mehr zeitgemäß sei. Als deutscher Mann kann ich leider nur schwer nachfühlen, ob tschechische Frauen wirklich so sehr an der Nachsilbe leiden, die sie durch ihr ganzes Leben tragen müssen. Doch wenn dem so sein sollte, so muss ich entgegenhalten, dass Tschechisch auch sehr frauenfreundliche Seiten hat, die der deutschen Sprache völlig fremd sind.
So bekommen Frauen, wenn sie in der Vergangenheit von sich selbst erzählen, durch jede weibliche Verbform ein Extra-“a” geschenkt. “Byla jsem v Praze”, sagt eine Frau, wenn sie erwähnt, dass sie in Prag gewesen ist, was eindeutig klangvoller ist als die männliche Äußerung “byl jsem v Praze”, und ich wette, dass ein tschechischer Kaffeeklatsch unter Frauen hunderte, wenn nicht tausende von “a” mehr enthält als ein tschechischer Männerstammtisch – außer natürlich, die Zechbrüder unterhalten sich den ganzen Abend über die Vergangenheit ihrer Frauen.
Und, nicht zu vergessen, die Ortsnamen. In Deutschland haben Städte und Dörfer überhaupt kein grammatikalisches Geschlecht und werden nur dann sächlich, wenn man ein Adjektiv voranstellt: “Das historische Nürnberg” oder “das idyllische Rothenburg” heißt es dann, aber “das Nürnberg” oder “das Rothenburg” gibt es nicht.
In Tschechien dagegen ist, beispielsweise, Brno sächlich, Liberec männlich, doch Praha (Staatshauptstadt!), Ostrava (Industriehauptstadt!) oder Plzeň (bald Kulturhauptstadt!) sind weiblich. Hinzu kommt: Orte, die auf “-ice” enden, und davon gibt es nicht wenige, sind sogar weibliche Plurale – eine Stadt wie Domažlice ist also, grammatikalisch gesehen, nicht nur eine Frau, sondern ganz viele Frauen auf einmal. Ich wage zu behaupten, dass die Weiblichkeit auf der tschechischen Landkarte in der Überzahl ist, da man ja gar nicht genau wissen kann, wie viele Frauen sich hinter einem Namen wie Jesenice oder Žlutice verbergen – sind es wirklich nur zwei, um dem Plural Genüge zu tun? Oder doch eher zehntausend? Deshalb würde ich sagen – lasst alles, wie es ist!
Ich persönlich würde, wäre ich eine Frau, gern die Prämie bezahlen, “Tannertová” zu heißen, wenn ich dafür mein Leben lang sagen dürfte “dělala jsem”, “řekla jsem”, “byla jsem” anstelle von “dělal jsem”, “řekl jsem”, “byl jsem”, denn: muss man nicht jeden Vokal im tschechischen Konsonantengehölz als Göttergeschenk betrachten?
Elmar Tannert