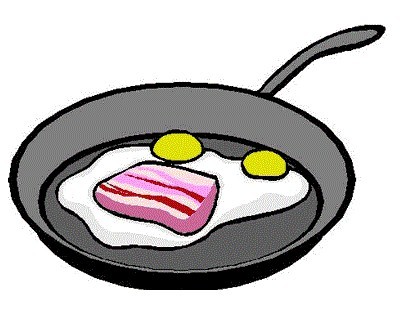Freunde auf die Hütte!
Ein guter Freund von mir handelt bei Restaurantbesuchen in der Fremde stets nach der Devise, sich nach Möglichkeit etwas Unbekanntes zu bestellen. Er sei noch nie enttäuscht worden, sagte er mir, im Gegenteil, oft habe er dadurch kulinarische Entdeckungen gemacht, während die anderen ihr Wiener Sicherheitsschnitzel aßen.
An ihn musste ich denken, als wir in einem Motorestlokal an der Fernstraße, die von Königgrätz ostwärts führt, die Speisekarte studierten und Hemenex entdeckten. Das klang exotisch, verheißungsvoll, fand ich, und ein bisschen nach Asterix und Obelix. Nur, leider, gehörte Hemenex zum Frühstücksangebot, und die Sonne stand bereits im Westen.
Ich scheute mich, den Kellner zu fragen, worum es sich bei Hemenex handle. Schon einige Male war es mir passiert, dass ich auf vermeintlich einfache Fragen – „entschuldigen Sie, wo ist der nächste Briefkasten?“ – äußerst weitschweifige Antworten bekommen hatte, die meine Vokabelkenntnisse bisweilen überforderten. Im Falle „Hemenex“ erwartete ich, dass der Kellner ungefähr sagen würde: „Hemenex? Das ist unser nationaler Zaubertrank, der bis heute nach dem Rezept gebraut wird, das unserer Fürstin Libusa im Jahr 934 als Traumvision erschienen ist. Ohne seine Zauberkraft wären wir verloren. Oder glauben Sie, wir würden es schaffen, unsere eigene Sprache zu lernen, wenn wir nicht schon seit Jahrhunderten die Schnuller unserer Säuglinge in Hemenex tränkten und den Kindern täglich zum Frühstück einen Becher Hemenex verabreichten?”
Mein Sohn meinte, dass „Hemenex“ eigentlich ganz ähnlich klinge wie „ham and eggs“. „Mag sein“, sagte ich. „Aber ‚prst‘ zum Beispiel klingt auch so ähnlich wie ‚Prost‘ und bedeutet ‚Finger‘. Auf so etwas darf man nicht hereinfallen.“
In den nächsten Reisetagen wurde ich zum Tyrannen. Frühmorgens um sieben warf ich meine Freundin und meinen Sohn aus dem Bett und schleifte sie durch die Straßen des jeweiligen Städtchens, in dem wir übernachteten, um in irgendeinem Lokal zum Frühstück Hemenex zu bekommen. Als die Suche endlich von Erfolg gekrönt war und ich erwartungsvoll Hemenex bestellte, kam zehn Minuten später leider kein altböhmischer Druide an unseren Tisch, um frisch aus dem Kessel Zaubertrank in unsere Tassen zu füllen, sondern, unter den schadenfrohen Blicken meines Sohnes, ein Kellner, der ham and eggs servierte.
Bis heute bin ich noch vielen Verwandten von Hemenex begegnet, und allmählich glaube ich, zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind – das ajfoun etwa, das tým, oder der Fußballfachbegriff ofsajd. Es handelt sich, meine ich, um einen schwejkisch-subversiven Plan, die Anglisierung Europas auszuhebeln, indem man englische Wörter durch die tschechische Sprachmühle dreht, bis sie von den angelsächsischen Muttersprachlern nicht mehr wiedererkannt werden. Nur Facebook wurde offenbar noch nicht geknackt. Vor einigen Tagen legte ich Tschechisch als meine Facebooksprache fest, stellte erstaunt fest, dass Facebook danach immer noch Facebook und nicht Fejsbuk hieß, und war noch erstaunter, als ich „přátelé na chatu“ las und als den wintersportlichen Aufruf „Freunde auf die Hütte“ interpretierte. Erst auf den zweiten Blick erkannte ich, dass nicht die tschechische chata, sondern der englische chat gemeint ist, doch musste ich mich fragen, wo in diesem Fall die tschechische Kühnheit geblieben war, die den chat in einen čet verwandelt hätte.
Sie darf nicht untergehen und schon gar nicht vor Fejsbuk einknicken! Wir Deutsche können einiges von ihr lernen. Schon ab morgen sollten wir „säil“ auf unsere Schaufensterscheiben und „lansch“ auf unsere Speisekarten schreiben, einen Großkundenbetreuer „Kiäkauntmännidscher“ buchstabieren und die Werbeaktion als „Promouschn“ – bis wir so viel Verwirrung gestiftet haben, dass wir reumütig zur Muttersprache zurückkehren.