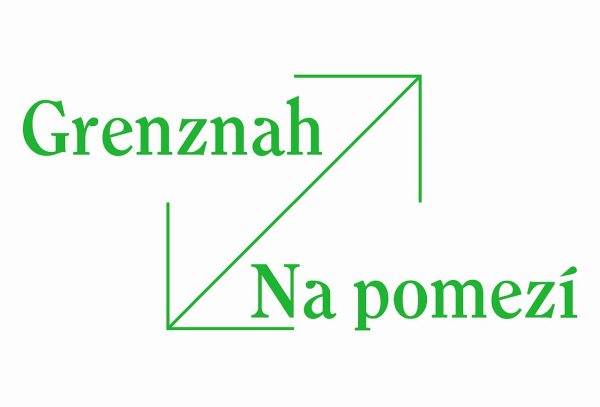Ich möchte dazu beitragen, der Gegend ihre Erinnerungen zurückzugeben
Gespräch mit Markéta Novotná
Frau Doktor Novotná, wann und warum kamen ihre Eltern nach Plan (Planá)?
Beide in den 1950er Jahren, beide der Arbeit wegen. In die westböhmische Gesundheitsfürsorge wurden sie auf Grundlage einer sogenannten Arbeitsplatzzuweisung geschickt, auf Beschluss des damaligen KNV (Bezirksnationalausschuss) in Karlsbad (Karlovy Vary). Mein Vater kam etwas eher, meine Mutter nach ihrem Studienabschluss. Beide waren Angestellte des OUNZ (Bezirksanstalt für Volksgesundheit) Marienbad (Mariánské Lázně). Plan gehörte zu der Zeit zum damaligen Bezirk Marienbad (dieser existierte von 1949–1960).
Haben sie sich in Plan kennen gelernt?
Sie haben sich Mitte der 1950er Jahre in Plan kennen gelernt. Mein Vater, der mit der Moldau getauft war, hat damals schon gearbeitet und meine Mutter, die aus Südböhmen stammte, kam als Medizinerin im Praktikum hierher. Genau wie viele andere Leute sind sie in der Grenzregion geblieben, weil sie hier Arbeit bekommen und auch eine Wohnung in Aussicht hatten. Direkt unterhalb des Krankenhauses wurde um 1960 ein kleiner Plattenbau errichtet. Dort haben sie eine Wohnung bekommen. Ich selbst habe mein erstes Lebensjahr noch im Krankenhaus verbracht. Meine Eltern hatten auch nach dem Umzug nur ein paar Meter Fußweg zur Arbeit.
Haben sich Ihre Eltern in Plan zu Hause gefühlt? Haben sie die Stadt annehmen können? Als Sie jung waren, war die Stadt wahrscheinlich im Verfall begriffen, oder?
Ich erinnere mich nicht daran, dass zu Hause darüber gesprochen wurde. Eine meiner ersten Erinnerungen sind Unterhaltungen meiner Eltern mit befreundeten Kollegen. Und sportliche Wettkämpfe in Volleyball und Fußballtennis. Ich erinnere mich an die damaligen Ärzte und wie ich ihre Weisheit und Hingabe im Beruf wahrgenommen habe. Ich glaube, dass meine Eltern eben wegen dieses Arbeitsumfeldes in der Grenzregion geblieben und nicht wie viele andere junge Leute weggegangen sind. Ich habe nie von ihnen gehört, dass sie darüber nachdenken würden, in die Heimatstadt meines Vaters oder meiner Mutter zurückzukehren.
Wenn sie sich nicht gerade über Sport unterhalten haben, über was haben sie geredet?Meistens ging es bei uns zu wie in einer Sprechstunde. Mir ist es nie seltsam vorgekommen, wenn beim Essen die Analysen verschiedenster Körperflüssigkeiten erörtert wurden. Schwächere Gemüter hätten angesichts solcher Themen wahrscheinlich den Tisch verlassen.
Sie sind regelmäßig in die Kirche gegangen und ihr Vater war der erste frei gewählte Bürgermeister nach der Wende. Wie war das für Sie, aus einer Familie von Ärzten zu kommen und gleichzeitig zu den Abweichlern zu gehören?
Zusammen mit meiner Schwester haben wir uns bei allem Möglichen engagiert, waren aber wahrscheinlich die Einzigen aus der Klasse, die nicht bei den Pionieren waren. Ich kann mich nicht erinnern, einen Tag in der Woche frei gehabt zu haben. Nach der Schule ging es zu verschiedenen Zirkeln, zur Musikschule, Sprachen wurden gelernt, Sport gemacht. Statt zu den Pionieren sind wir zum Angelzirkel gegangen, weil das Angeln auch zu den Hobbies meiner Eltern zählte. Dass ich nicht bei den Pionieren war, habe ich nicht besonders zu spüren bekommen. Ich war so beschäftigt, dass niemand hätte sagen können, dass ich mich nicht genügend einbringe. Vom Klassensprechersein über verschiedene Wettbewerbe. Uns so sind die Pioniere irgendwie an mir vorbeigegangen.
Wie sah das Leben um die Kirche herum aus? Sind außer Ihnen nur ältere Leute regelmäßig zum Gottesdienst gegangen, der Rest hatte Angst?
Zur Kirche sind vor allem die mittlere und ältere Generation gegangen. Aber damals als Kind kamen mir eigentlich alle über zwanzig „alt“ vor. Schöne Erinnerungen habe ich an Pater Záruba. In der Zeit des Prager Frühlings Ende der 60er Jahre gab er Religionsunterricht, an dem, zumindest am Anfang, viele Kinder teilnahmen. Er war liebenswürdig, mit Sinn für Humor. Er hat uns auch das Matthäusevangelium von Pasolini schauen lassen. Das war unglaublich. Von der Schule aus haben wir nur Kriegsfilme angesehen, nach denen ich immer eine Woche nicht schlafen konnte. Erst viele Jahre später ist mir bewusst geworden, was der Pfarrer in uns angelegt hat und auf welch unterhaltsame Weise er uns das alles beigebracht hat. Bibelwissen hat er in Form von Wettbewerben geprüft, bei dem wir Heiligenbildchen gewinnen konnten. Wir haben versucht uns gegenseitig darin zu übertrumpfen, wer mehr wusste und dann die Bildchen untereinander getauscht. Danach haben wir immer Kuchen gegessen, den die Schwester vom Pfarrer gebacken hatte. Diese glückliche Zeit war 1968–1970, soweit ich mich richtig erinnere.
Plan ist eine historische Stadt, eine der schönsten in der Gegend. Sie haben hier Informationstafeln aufstellen lassen und viele Vorträge gehalten. Wann haben Sie begonnen, Plan als einen Ort wahrzunehmen, der Sie interessiert?
Seit meiner Kindheit habe ich mich für „Ereignisse und Objekte von früher“ interessiert. Zum Beispiel der Kornspeicher aus dem Josephinismus, also aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der in der Pilsner Straße stand. Bis heute halte ich seinen Abriss für einen der größten Verluste an historischen Baudenkmälern in der Stadt. Das war ein monumentales Gebäude und so habe ich ihn auch wahrgenommen. Diese Denkmäler haben mit der Zeit viele Frage in mir hervorgerufen. „Wer? Wann? Warum? Was steht das?“ Ich habe die Menschen hinter den Denkmälern erahnt. Menschen wie wir, die vor uns hier waren.
Wann ist Ihnen bewusst geworden, dass diese Leute eine andere Sprache sprachen?
In Plan konnte man alte Leute treffen, die Tschechisch mit einem seltsamen Akzent gesprochen haben. Sie hatten andere Nachnamen und redeten untereinander in einer anderen Sprache. Erst viele Jahre später habe ich festgestellt, dass sie die gleichen Nachnamen haben wie mache alte bürgerliche Planer Familien. Sie kamen mir vor wie aus einem historischen Film, z. B. der Professor Raps.
Welche Quellen gab es und wie war das Interesse an der Geschichte des Ortes, an dem Sie gelebt haben? Die auf Deutsch verfasste Geschichte der Stadt Plan ist schließlich bis heute nicht ins Tschechische übersetzt worden und das Verfassen eines neuen solchen Werkes wartet als Aufgabe anscheinend auf Sie?
In meinem Fall war der Einfluss von zwei Lehrern, Herrn Kváč und Herrn Veverka, entscheidend, die Heimatkunde und Geschichte unterrichtet haben und die den Stoff auf so eine Art und Weise vermitteln konnten, dass es mir immer leid tat, wenn die Stunde zu Ende war. Damals habe ich mir gesagt, dass es überall so unglaublich interessante Dinge gibt, und bei uns wird das sicher auch so sein. Also habe ich meine Großeltern ausgefragt, die noch zur Zeit der Monarchie geboren waren. Und allmählich habe ich mich an die deutsche regionale Literatur herangetastet. Viel gibt es davon übrigens nicht.
Wie haben Sie den Abriss des Renaissancehauses erlebt, dort, wo jetzt das Einkaufszentrum Hraničář steht?
Den Abriss der wahrscheinlich wertvollsten Häuser auf dem Marktplatz habe ich nicht miterlebt. Ich kann mich aber erinnern, wie mir die Lücke, die sie hinterlassen haben, immer so fehl am Platz vorkam. Der Platz wurde später vom Zirkus oder für den Rummel genutzt. Und es hat dort immer gezogen. Instinktiv habe ich schon damals diese Baulücken, die die abgerissenen Häuser hinterließen, als Störung der Gesamtheit empfunden, hauptsächlich im historischen Stadtkern und der Straße Dukelských hrdinů. Und diese bestehenden oder neu entstehenden Lücken in der alten Bebauung provozierten in mir die Frage nach dem Schicksal dieser verschwundenen Objekte. Damals habe ich nicht gewusst, dass durch den Abriss des Renaissancegebäudes auf dem Marktplatz ein Denkmal verschwunden ist, über das auch in Monografien geschrieben worden war, die in ganz Tschechien herausgegeben worden waren. Ich selbst habe z. B. die Liquidierung des ursprünglichen Planer Friedhofs miterlebt. Heute weiß ich, dass er unglaublich wertvoll war. Die Grabsteine, auf denen ein großer Teil der Planer Geschichte verewigt war, verschwanden in den Fundamenten der hölzernen Umkleiden im Planer Freibad. Ich habe daran bildliche Erinnerungen, verbunden mit dem Gefühl „hier verschwindet etwas, was nicht verloren gehen sollte.“
Machen wir den Sprung aus der Kindheit in die Fachwelt. Was war das Wertvollste, was in Plan verschwunden ist?
Außer dem Kornspeicher, den Renaissancehäusern und dem Friedhof, den ich erwähnt habe, ist für mich die unsensible Renovierung des Planer Rathauses besonders schmerzlich. Die Renovierung wurde in den 1960er Jahren vorgenommen und dabei ging ein großer Teil der historischen Substanz des Rathauses verloren. Über dem Portal fehlt die Nische, in der sich die Justitiastatue befand. Außerdem sind in Plan zwei Brunnen verschwunden, die den Leuten in der Petersvorstadt dienten. Ich glaube, dass bei uns kein von der Einwohnerzahl und Größe her vergleichbar Ort existiert, der so eine große Anzahl an erhaltenen Brunnen in allen drei Stadtteilen vorzuweisen hätte.
Was finden wir sonst noch Einzigartiges in Plan?
Plan hat in vielerlei Hinsicht eine bemerkenswerte Geschichte und einen versteckten Charme, die einzigartig für die Stadt sind. Ein Teil des alltäglichen Gedächtnisses der Stadt ist mit ihren ursprünglichen Bewohnern fort gezogen. Aber in den erhaltenen Dokumenten wird die Geschichte sichtbar und die Menschen, die die Vergangenheit rekonstruieren, können sich an der Entwicklung der Verwaltung, an der Militärgeschichte und der Wirtschaftsgeschichte orientieren oder sie können sich der Geschichte der einzelnen Adelsfamilien in der Region widmen. Die Geschichte der jüdischen Besiedlung habe ich teilweise schon bearbeitet, also dieses Thema ist schon nicht mehr ganz „frei“. Bislang fehlt auch eine kunsthistorische und architektonische Bewertung. Ein Thema, das noch auf seine Bearbeitung wartet, ist die Entwicklung der Infrastruktur. Die Eisenbahn Kaiser Franz Josephs I. brachte die Entwicklung des Bahnhofsviertels in Gang und seinen Anschluss an die Stadt. Die Straße, die den heutigen Autobahnzubringer bildet, wurde kurz vor dem II. Weltkrieg angelegt. Diese Straße verlief durch den Schlosspark und dank der guten Instandhaltung wird sie bis heute benutzt. Aber wenn wir es mal der Reihe nach betrachten, so sind die Quellen zur ältesten Geschichte der Stadt Plan nur sehr bruchstückhaft, ich würde sagen, sie sehen aus wie die „Noten für eine Trommel“. Als Erster beschäftigte sich mit der Geschichte der Stadt Eduard Senft, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Facharbeit zu diesem Thema und über den Herrschaftssitz Plan vorlegte. Ein Freund von Senft knüpfte an seine Arbeit an, er war Arzt von Beruf, was am Ergebnis seiner Arbeit zu sehen war. Noch vor dem zweiten Weltkrieg wurde die in gemeinsamer Arbeit entstandene Planer Heimatkundeherausgegeben. Es wird aber sowieso unausweichlichsein, ganz am Anfang zu beginnen und die Quellen und die Grundlagenliteraturauf dem tschechischen und deutschen Gebiet durchzugehen. Die Adelsfamilien – die Planer, Seeberger, Elsterberger, seit Anfang des 16. Jahrhunderts dann die drei großen Adelsgeschlechte: Schlick, Sinzendorf und Nostitz. Die letzten Vertreter blieben bis zum Ende des Feudalismus bzw. noch in den ersten Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Einiges ist schon erforscht, aber vieles liegt noch im Verborgenen.
Wenn in Plan jemand die Spuren eines Adligen verfolgen wollte, eine Stunde Zeit hätte und alles geöffnet wäre, wohin sollte er gehen?
Mit Sicherheit zum Burghügel, auf dem sowohl die Burg als auch das Schloss errichtet wurde. Die Stadtkirche Maria Himmelfahrt sollte er sich anschauen, wo unter dem Altar eine ehemalige Gruft der Schlicks zu finden ist. Sie ist leider schon leer. Die Urkunden darüber sind aber erhalten und es bleibt ein Rätsel, ob hier wirklich Joachim Andreas von Schlick beigesetzt wurde, der am 21. Juni 1621 auf dem Altstädter Ring in Prag enthauptet wurde.
Wohin wurden seine Überreste gebracht?
Nirgendwohin. Als die Notsitze die Herrschaft übernahmen, war die Gruft schon mehrere Male geöffnet worden. Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts wurden die Zinnsärge an Zinngießer verkauft und die Knochen in hölzerne Truhen geschüttet. Die Beschriftungen der ursprünglichen Särge und auch einige in die Mauern der Stadtkirche eingemauerte Grabsteine der Schlicks sind jedoch erhalten geblieben. Sie haben einen hohen Aussagewert. Über sie wurde auch noch nicht alles geschrieben, was es zu erzählen gäbe. Die Nostitzer haben eine neue Gruft angelegt, bei der St.-Anna- Kirche, gegenüber dem Haupteingang. Die ist bis heute erhalten und in einem guten Zustand.
In der Kirche findet man neben dem Altar mit der in den Himmel tanzenden Jungfrau Maria auch eine sehr eindrucksvolle Golgota- Darstellung mit Gekreuzigten, bei deren Anblick einem schaurig wird. Gegenüber ist ein Marienbild in einem dekorativen Rahmen.
Ich denke, hier sollte man vor allem den Wolkenaltar im Nordschiff der Kirche erwähnen. In der Mitte des Altars ist ein Bildnis – eine Szene mit der Jungfrau Maria und dem Jesuskind zusammen mit Johannes dem Täufer. Auf dem ersten Blick fallen einem auf dem Bild drei Flecken auf, die Zeugnisse von Durchschüssen sein sollen. Der Legende nach hing das Bild ursprünglich an der Hauswand eines Gebäudes links vom Rathaus. Als Plan während des 30-jährigen Krieges von den Schweden eingenommen worden war, machten die schwedischen Soldaten einmal auf dem Weg aus der Kneipe „Zum weißen Pferd“ das Bild zur Zielscheibe. Sie waren betrunken, so dass die meisten Schüsse danebengingen. Dreimal wurde das Bild aber getroffen. Das Bild wurde abgenommen und in die Kirche gebracht, wo es später an den eigens angefertigten Wolkenaltar angebracht wurde. Dieses Ereignis wurde sehr viel später auf die Altarplatte gemalt. Deshalb entsprechen die Uniformen der Soldaten auch nicht den schwedischen Uniformen aus der Zeit des 30-jährigen Krieges. Die Szene wurde dann noch einmal an der Stirnseite des Hauses aufgemalt, wo sich das ganze zugetragen hatte. Irgendwann nach 1945 ist die Darstellung jedoch verschwunden. Der Autor der sogenannten Planer Madonna ist bis heute nicht identifiziert, das Bild entstand aber am Ende der Renaissance oder im frühen Barock. Eine Kopie des Bildes kann man im Böhmerwaldmuseum in Tachau (Tachov) sehen.
Die Namen der im I. Weltkrieg gefallenen Soldaten aus Plan sind auch relativ untypisch in der Kirche angebracht…
Die Planer Bürger haben sehr lange gebraucht um sich auf eine Form und das Aufstellen eines Denkmals für die Gefallenen zu einigen. Durch das Zutun des damaligen Dekans Schmidt ist man schließlich darauf gekommen, schwarze Tafeln in der Kirche anzubringen, auf denen in goldener Schrift mehr als siebzig Namen von Männern aus Plan stehen, die nach dem Ersten Weltkrieg nicht von der Front heimgekehrt sind. An den Tafeln fand jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung statt. Wir wissen also, wer aus Plan gefallen ist. Wer weiß, was mit dem Denkmal passiert wäre, wenn sie es irgendwo draußen aufgestellt hätten. Interessant ist auch ein Bild, das ebenfalls im Nordschiff der Kirche hängt. Es befindet sich über den Gedenktafeln und hat die atypische Form eines unregelmäßigen Trapezes. Auf ihm ist eine für die Entstehungszeit relativ typische Szene abgebildet, die eine trauernde Familie am Grab eines „Kriegshelden“ darstellt. Gemalt wurde es vom Planer Maler Franz Josef Rausch, der auch der Autor der Fresken im Planer Rathaus ist.
Was ist auf den Fresken im Planer Rathaus zu sehen?
Dort sind Allegorien abgebildet, die auf die Antike verweisen und die Haupttätigkeit der Stadt und des damaligen Kreises charakterisieren – Ackerbau, Handel und Handwerk. Auf dem Giebel sind die Heiligen dargestellt, denen die Planer Kirche geweiht sind.
Die Peter-und-Paul-Kirche ist auch außergewöhnlich für dies Gegend…
Sie ist eines der ältesten Planer Baudenkmäler, einzigartig durch ihr romanisches Portal, das von einem sogenannten Bogenfries eingefasst ist. Ein solches Element befindet sich in Plan an einem kirchlichen Bauwerk, ein zweites im Turm der Burgruine Wolfstein bei Tschernoschin (Černošín). Die Kirche ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Überrest des einstigen Ortes Plania, der sich schon vor der Entstehung der Stadt unterhalb des Bohušov-Hügels (Bohuschaberg) befunden haben soll. Archäologische Untersuchungen konnten hier die Existenz einer slawischen Siedlung aus dem 9.–10. Jahrhundert nachweisen. Die Fresken in der Peterund- Paul-Kirche stammen aus dem 13. Jahrhundert. Auf dem Friedhof bei der Kirche wurden noch im 18. Jahrhundert Kriegsopfer beigesetzt. Die Kirche und den Friedhof löste Joseph II. auf.
Man hatte erwartet, dass Plan mit Silber zu Reichtum kommt, was aber nicht so ganz geklappt hat…
Zur Geschichte des mittelalterlichen Bergbaus in Plan sind leider nicht besonders viele Dokumente erhalten geblieben. Es fehlt allgemein zum Bergbau in Plan eine systematische und konsequente Untersuchung. Soweit ich mich erinnere, wurden mehrmals Untersuchungen aus Sicherheitsgründen durchgeführt, wenn z.B. irgendwo eine Absenkung auftrat oder es notwendig war, bestimmte Stollen zu begutachten. Das ist eines der Themen, das meiner Meinung nach eine gründliche Nachforschung erfordert, bevor man genaue Schlussfolgerungen ziehen kann.
Häufig hört man die Interpretation, dass die Stollen keinen Ertrag brachten und für die von Schlicks eher ein Verlustgeschäft darstellten.
Da stimme ich in gewissem Maße zu. Aber der neuzeitliche Bergbau fand größtenteils außerhalb von Plan statt. Die Hauptabbaustätten lagen bei Michelsberg (Michalovy Hory).
Wenn das Schloss nicht vor Kurzem ausgebrannt wäre und die Burg geöffnet wäre, was würden wir dort Interessantes finden?
Vor allem Hinweise auf die ursprünglichen Burgbauten, die spätestens im 13. Jahrhundert entstanden sind. Wir finden dort auch die in römischen Ziffern aufgeprägte Jahreszahl 1400. Mit großer Wahrscheinlichkeit weist sie auf den Wiederaufbau der Burg nach einem verheerenden Brand hin. Auch ein steinerner Stützpfeiler ist erhalten, der Teil der ursprünglichen Burg war. Der Planer Herrschaftssitz hätte ohne Zweifel eine umfangreiche und gründliche bauhistorische Untersuchung verdient.
Können Sie sich an die Grenzsoldaten im Schloss erinnern?
Selbstverständlich. Als neugieriges Kind hat mich das ziemlich gestört, dass man dort nicht hindurfte. Von Innen habe ich das Schloss erst nach 1989 zum ersten Mal gesehen. Damals war schon keine Spur mehr von der Ausstattung vorhanden, die auf einigen wenigen erhaltenen Fotografien festgehalten worden war. Erhalten blieben u.a. Kratzmalereien aus der Renaissancezeit, hölzerne Wandungen, Gewölbe. Ich bin allerdings besorgt, inwieweit der Brand, der vor Kurze wütete, den klassizistischen Flügel beschädigt hat und wie sein weiteres Schicksal aussehen wird, das gleiche gilt für die übrigen Objekte des Schlosses. Ich wäre wirklich glücklich, wenn es gelingen würde, dieses Areal zu retten und eine sinnvolle Nutzung dafür zu finden. Der gesamte Hügel bildet ein bemerkenswertes Ganzes aus Wohnobjekten, Wirtschaftsgebäuden einschließlich Häusern für Beamte. Die jetzige Straße, die um das Schloss führt, verlief früher um viele Meter weiter tiefer. Dort waren ein Graben und darüber eine Brücke, über die ein Weg zu einem Bergsporn und zur Burg, später zum Schloss führte. Diese Stelle war von allen Seiten her gut geschützt. Steile Hänge, darunter Morast. Die Natur selbst schützte die ganze Anhöhe. Außerdem gab es dort natürlich Befestigungsanlagen und Gräben. Die Burg wurde manchmal Bärenburg genannt, im Burggraben sollen angeblich Bären gelebt haben. Auch die sogenannten Nostitzer Pferdeställe sind interessant. Viel ist durch unsensible Eingriffe der Grenzpolizei oder durch den bisherigen Verfall zerstört worden. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es möglich ist, dem Burgberg wieder Leben einzuhauchen.
Wir haben uns über die bedeutendsten Gebäude in Plan unterhalten. Wie ist die Struktur der Stadt? Sie hat zwei Marktplätze und einen Burgberg.
Über die Stadtstruktur muss man mit Fachleuten für Städtebau reden. Nichts desto trotz sagt die Legende, dass sich vor langer, langer Zeit an der Straße nach Pilsen um die Vorburg der einstigen Festung auf dem Bohušov-Hügel herum und in der Nähe der Peter-und-Paul-Kirche die ursprüngliche Ansiedlung Plania erstreckt haben soll. Vom Typ her wahrscheinlich ein Straßendorf. Am anderen Ende, auf dem Bergsporn über dem Planer Bach, stand eine weitere Festung. Das Areal zwischen den beiden Festungen soll der Legende nach als Kampfplatz für das ritterliche Lanzenstechen gedient haben. Im 13. Jahrhundert kam es hier zur Gründung der Stadt. Die Form des Marktplatzes zeugt davon, dass es sich um eine gezielt angelegte, ausgemessene, und nicht spontan entstandene Anlage handelt. Er ist das Werk eines Lokators, höchstwahrscheinlich aus der Zeit der Premysliden. Plan war ursprünglich eine Königsstadt. Die erste schriftliche Erwähnung aus dem Jahr 1251 handelt davon, dass König Wenzel I. die Verwaltung der zur Planer Kirche gehörenden Gemeinde den Mönchen aus dem Kloster Waldsassen überträgt. Hier wird deutlich, was sich wie ein roter Faden durch die gesamte Planer Geschichte zieht. Heute würden wir das als grenzüberschreitende Zusammenarbeit bezeichnen. Die Urkunde wurde vom König herausgegeben, was bezeugt, dass sich die Stadt seiner Gunst freute. Bereits im 14. Jahrhundert ist die Rede davon, dass die Stadt befestigt ist. Ob es dann von Osten oder Westen her zur Bebauung entlang der heutigen Straße Dukelských hrdinů kam, ist eine bislang unbeantwortete Frage. Bis zum Jahr 1945 hieß diese Gegend Petersvorstadt. Sie stellt die Verbindung zwischen der ursprünglichen Siedlungsstätte und der befestigten Stadt dar. Anfang der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts brach in diesem Viertel ein schrecklicher Brand aus, von dem nur einige wenige Häuser verschont blieben. Deshalb sieht die ganze Bebauung auch anders aus, die Häuser wurden nach dem Brand in dem Stil wieder aufgebaut, der Mitte des 19. Jahrhunderts vorherrschte. Der historische Wert ist heute im Erdgeschoss und vor allem in den Kellern der Gebäude verborgen.
Das Haus des Malers Jan Knap ist ein Planer Beispiel aus dem späten Barock und der Renaissance. Sah so das alte Plan aus?
Das ist nicht ausgeschlossen. Wir können uns Plan zur Zeit der Renaissance so vorstellen. Gleichzeitig ist das Haus mit der Nummer 35 ein Beispiel dafür, wie ein gotisches Haus mit einem Maßhaus und einem Barockanbau zum Hof hin, auf einer langgestreckten gotischen Parzelle saniert werden kann. Die Sanierung dieses Hauses zeigt, welches Ergebnis möglich ist, wenn die Arbeit von Fachleuten ausgeführt wird. Und noch eine Ergänzung zu den Häusern in Plan. Plan wurde in der Vergangenheit häufig von Bränden heimgesucht. Deshalb ist auf der Nepomuksäule auf dem Marktplatz auch eine Statue des Hl. Florian, der als Beschützer vor Feuer und Patron der Feuerwehrleute gilt. Jeder Brand hat eine Veränderung in der architektonischen Gestalt der Stadt mit sich gebracht. Im 19. Jahrhundert wurden leider auch die Dachstühle der Häuser an der Nordseite des Marktplatzes umgedreht. Bis dahin waren die Giebel der Häuser zum Marktplatz hin ausgerichtet, wie es bis heute bei den Häusern an der Südseite des Marktplatzes zu sehen ist. Die Welle der baulichen Veränderungen am Ende des 19. Jahrhunderts ließ teilwiese die mittelalterliche Gestalt des Platzes verschwinden. Durch sensible Rekonstruierung kann aber eine Reihe von bis heute zum Teil versteckten baulichen Elementen aus den früheren Stilepochen wiederhergestellt werden.
Gibt es dafür eine Art Anleitung? In Bayern gibt es für solche Fälle die vom Staat finanzierte Stelle der „Heimatpflege“.
Durch meine tägliche Arbeit im Archiv weiß ich, dass man viele Informationen finden kann, auch Investoren kann man viele Tipps und Ratschläge bezüglich des früheren Zustands eines Hauses geben. Es kommt auf den Willen an, die finanziellen Möglichkeiten, die Zeit und die Absprachen mit den zuständigen Spezialisten. Die Eigentümer, die Stadt und der Staat könnten viel aktiver sein.
Die Stadt hat vor Kurzem die ehemalige Münzwerkstatt Schlick und das Meďár genannte Jugendstilhotel gekauft. Könnten Sie uns zu diesen beiden Gebäuden etwas sagen?
Beide Gebäude verdienen die Aufmerksamkeit der Repräsentanten der Stadt, aber auch jedes Bürgers. Heute ist die Stirnseite des Hotels im Jugendstil (die Umgestaltung stammt aus den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts). Im Laufe der letzten Jahrhunderte war das Gebäude überwiegend im Besitz der Stadt, die es an verschiedene Betreiber vermietet hat. Dieses Haus hat die wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse der Stadt miterlebt. Die Räume dienten auch als Unterrichtsräume. Das Gebäude, das Münzwerkstatt genannt wird, bestand ursprünglich aus zwei Bürgerhäusern. Unter den Schlicks wurde die Münzstätte daraus gemacht. Nachdem die Münzprägung eingestellt worden war, richteten die nachfolgenden Herrscher Sinzendorf und Nostitz dort die herrschaftliche Brauerei ein. Der Brauereibetrieb hielt sich bis zum Jahr 1903. Später waren in dem Haus Wohnungen, im Kommunismus wurde es als Lager der Firma Skoda und für weitere Zwecke genutzt. Auch hier könnten während der Sanierung Dinge zum Vorschein kommen, die zum Gesamtverständnis der Geschichte der Stadt beitragen.
Meďár, also das Hotel „Zum schwarzen Bären“, hatte seinen Namen von den Bären, die im Schlossgraben lebten?
Schwer zu sagen. Ich würde eher tippen, dass der Name aus den Gewohnheiten der damaligen Einwohner entstanden ist. In Plan gab es das Gasthaus „Zum schwarzem Adler“, solche und ähnliche Namen waren üblich.
Plan war früher Bezirkshauptstadt, der Bezirk hieß damals Plan- Weseritz. War es für Plan Glück oder Unglück, als es nicht mehr Bezirkshauptstadt war? Was für Gebäude finden wir hier aus der Zeit als Plan, sagen wir mal, eine bedeutendere Rolle für den ganzen Staat spielte?
Der Bezirk Plan wurde 1949 endgültig aufgelöst. Als geborene Planerin glaube ich, dass die Entscheidung, Verwaltungsämter und andere Behörden hier schließen und Plan zuerst dem Bezirk Marienbad und dann ab 1960 dem Bezirk Tachau zuzuordnen, nicht gerade die beste war. Die Stadt sowie die Region Plan konnten auf eine jahrhundertelange, kontinuierliche Entwicklung im Gerichts-und Verwaltungswesen zurückblicken. Der Gerichtsbezirk Plan war im Prinzip der Nachfolger der einstigen Herrschaft Plan. Zum politischen Bezirk gehörte auch der Gerichtsbezirk Weseritz (Bezdružice), der größtenteils aus der ehemaligen Herrschaft Weseritz bestand. Weseritz war von 1949–1960 in den Bezirk Mies eingegliedert. In Plan war der Sitz des Bezirksgerichts, des Bezirksamts und einer Reihe anderer Behörden. Nach 1960 kam es im Rahmen weiterer Reformen zur Angliederung des damaligen Bezirks Plan mit Ausnahme einiger weniger Orte zum Bezirk Tachau. Absurd war die Tatsache, dass in Plan die Räumlichkeiten für das Bezirksgericht und das Bezirksamt vorhanden waren. 1875 war hier eines der größten Gebäude weit und breit errichtet worden, die Bezirkssparkasse. Einen Teil seiner Räumlichkeiten stellte sie dem Bezirk als Amtsräume zur Verfügung. Hier war auch die städtische „Arrestzelle“ untergebracht. Dieses Objekt ist den Planern als ehemaliges Triolawerk bekannt. Heute ist es zu einem Wohnhaus umgebaut. Das Gericht hatte seinen Sitz im Rathaus. Plan hatte für die Behörden die nötigen Räumlichkeiten und die Ausstattung. Außerdem gab es ein Gymnasium. Von der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert bis 1974. Es war eine Mittelschule, die über die Zeit ihres Bestehens hinweg ungefähr 20 verschiedene Bezeichnungen trug. Sie brachte Abiturienten auf hohem Niveau hervor. Die Schüler lernten in einem der damals modernsten Schulgebäude des Landes. Die Schließung des Gymnasiums war für Plan auf keinen Fall von Vorteil.
Wenn wir zu Ihren persönlichen Erinnerungen zurückkommen, wie haben Sie die Grenze erlebt? Sie war 15 Kilometer entfernt. Man durfte nicht dort hin. Haben Sie von Gerüchten von Schüssen an der Grenze gehört?
Als Kind habe ich einige Mitschüler gehabt, die Kinder von Angehörigen der Grenzschutztruppen waren. Oder anderer bewaffneter, nicht uniformierter Einheiten. Einige von ihnen waren in den sogenannten Jungen Grenzschützern organisiert. Sie haben über verschiedene Erlebnisse berichtet, die manchmal nicht unbedingt der Wahrheit entsprachen. Zum Beispiel kam einmal ein Mitschüler in die Schule und hatte eine Schnittverletzung. Er behauptete, dass er sie davon habe, dass er einen Staatssaboteur gejagt hätte. Er war damals vielleicht dreizehn. Die ideologische Führung wurde so umgesetzt, dass wir uns als Kinder über die Existenz der Grenze als etwas Unnatürliches keine Gedanken gemacht haben. Pilze sammeln durfte man eben nur in bestimmten Gebieten. Von Schüssen haben wir normalerweise nichts mitbekommen. Außergewöhnliche Vorkommnisse wurden damals geheim gehalten. Aber wir wussten, dass die Welt „auf der anderen Seite“ anders aussieht, als uns offiziell serviert wurde. Plan liegt im Schatten des Bohuschabergs. Egal, in welche Richtung wir die Fernsehantennen damals gedreht haben, die Sonntagsmärchen und andere tschechische Sendungen waren schlecht zu empfangen, das Bild hat geflackert. Dafür funktionierten einige deutsche Fernsehsender. Wir durften zwar nicht über die Grenze, aber im Fernsehen konnte man nichts anderes einigermaßen vernünftig empfangen als Deutschland, wo sie uns nicht hingelassen haben. Ansonsten gehörten die undurchlässige Grenze und ihre Wächter zur alltäglichen Realität. Wenn die Arbeitszeit zu Ende war, war der Planer Marktplatz voll von Männern in Uniformen. Zum Jubiläum der Oktoberrevolution oder am 1. Mai mussten wir uns Vorträge anhören. Auch von den Grenzschützern. Was genau sie gesagt haben, habe ich lieber gleich nach der Veranstaltung vergessen.
Ein Austausch der kompletten Bevölkerung. Kam Ihnen, als professionelle Historikerin, jemals der Gedanke, wie seltsam das ist, dass eine ganze Stadt wegzieht und dann andere Leute hinziehen?
Ich muss zugeben, dass sich mein Gesamtbild darüber erst geformt hat, als ich begonnen habe, mich mit der Regionalgeschichte zu beschäftigen. Für mich als Historikerin bedeutet das, dass die Zeitzeugen weggegangen sind. Die Erinnerungen konnten nicht mehr weiter gegeben werden. Das tut mir leid, dass es niemanden gibt, den ich fragen kann. Wenn ich etwas in den regionalen Medien entdeckt habe oder an erhaltene Dokumente gekommen bin, gab es niemanden, den ich nach den Zusammenhängen fragen konnte. Als ich dann später Zugang zu den Erinnerungen hatte, die im Nachkriegsdeutschland in Büchern festgehalten worden waren, musste ich oft feststellen, dass inzwischen die Dokumente darüber verschwunden waren, was die damaligen Planer dazu geschrieben hatten. Je älter ich werde, desto mehr sehe ich meine Hauptaufgabe darin, dazu beizutragen, die Erinnerungen wiederzufinden und auf die konkreten Menschen hinter den deutschen Zeugnissen aufmerksam zu machen, vor allem bei kleineren Zeugnissen der Geschichte. Damit die Leute wissen, was die Gebäude und andere Objekte, an denen sie täglich vorbei gehen, alles erlebt haben. Und dabei geht es nicht nur um eingetragene Denkmäler. Ich bemühe mich fachkundig zu erfassen, was sie aussagen, und was sie uns für die Zukunft mitgeben.
Wie haben Sie Deutsch gelernt? Das war ja nicht üblich.
An der Grundschule hatte ich Deutsch als Wahlfach, an der Mittelschule und Hochschule habe ich damit weitergemacht. Und ich habe deutsches Fernsehen geschaut. Ich musste an die Informationen über die Vergangenheit der Stadt kommen. Die Quellen sind für unsere Region überwiegend auf Deutsch.
In Plan gab es ein Museum. Was ist daraus geworden?
Das Gebäude gibt es noch. Ein sehr schönes Barockbauwerk an der südöstlichen Ecke des Planer Marktplatzes. Dort war das Museum nach dem Krieg untergebracht. Als die Deutschen noch hier waren, war das erste Museum in dem Gebäude neben dem Pfarrhaus, heute gehört das Objekt zu einer Berufsschule. Dann wurde es in das Objekt der Münzwerkstatt verlegt. Dort gab es wahrscheinlich ziemlich große Pläne, aber der Zweite Weltkrieg machte sie zunichte. Das Planer Museum verfügte über eine weithin bekannte und bedeutende naturwissenschaftliche Sammlung. Von der Sammlung ist nur ein kleiner Teil erhalten geblieben, der in den 1960er Jahren ins Bezirksmuseum nach Tachau gebracht wurde.
Wenn Sie jemanden von den einstigen Einwohnern der Stadt Plan treffen könnten, und Sie kennen sicher mehr von ihnen, als sonst jemand von den heutigen Planern, wem würden Sie am liebsten begegnen?
Mit Sicherheit meinem „Kollegen“ Eduard Senft. Er war der erste und einzige Autor der relativ fachkundig verfassten Geschichte von Plan. Er hat es bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschafft. Wir hätten uns mit Sicherheit viel zu erzählen. Dann würde ich gern seinen Weggefährten und Nachfolger Dr. Michal Urban sehen. Das Grab von Eduard Senft auf dem alten Planer Friedhof ist leider verschwunden. Die Familiengruft der Urbans befindet sich bis heute auf dem neuen Planer Friedhof. Das wäre sicherlich eine spannende Debatte. Besonders Eduard Senft ging sehr fachmännisch mit Quellen um. Aber mit der Zeit werden neue Dinge entdeckt und damit die Interpretation verschoben. Aber am allerliebsten würde ich gerne den Menschen treffen, dessen Gesicht wir bis heute kennen. Stefan Schlick, den ersten Herrscher aus dem Hause der Schlicks in Plan. Leider ist er in der Schlacht bei Mohacs gegen die Türken 1526 gefallen.
Lauter Männer. Lebte hier auch eine Frau, die Ihre Aufmerksamkeit erregte?
Zweifellos Marie von Nostitz-Rieneck, die zwischen den Weltkriegen starb. Sie war im Kreis weithin als Menschenfreund bekannt.
Gab es nach 1945 tschechische Persönlichkeiten, die erwähnenswert wären?
Auf dem Gebiet der Geschichte wäre da der Museumsverwalter und Konservator der Denkmalpflege Herr Kalandra. Im örtlichen Krankenhaus gab es heute legendäre Chefärzte (Vrzala, Tomek, Němčák, Žantovský….). Der Lehrer und Sportler Herr Staněk war ein toller Repräsentant des Fair Play. Der Lehrer Herr Myslivec, der mehrere Musikinstrumente beherrschte, unglaublich viel über Musik wusste und das auch vermitteln konnte. Jahrzehntelang war der Leiter des Kinos eine eindrucksvolle Persönlichkeit, Herr Kalaš, dank ihm hatten die Planer u.a. einen Filmklub.
Am Ende unseres Interviews verlassen wir die Stadt – wir begeben uns zu St.-Anna. Dieser Wallfahrtsort macht Plan einzigartig. Die ehemaligen Planer haben sich auf der deutschen Seite der Grenze nach dem Krieg eine Kapelle mit dem gleichen Namen gebaut, sogar mit einem Aussichtsturm, von dem aus sie bis „nach Hause“ sehen konnten…
Meine ersten Erinnerungen an St.-Anna stammen aus meiner Kindheit. Ich wollte mir die Kirche von Innen anschauen, aber das ging nicht, denn sie war verschlossen. Ich kannte auch die versiegte angebliche Heilquelle, die wegen der Abbauarbeiten im nahegelegenen Uranstollen aufgehört hatte zu fließen. Nach und nach wurde mir klar, warum die ehemaligen Planer Bewohner diese Kapelle und den Aussichtsturm gebaut haben. Sie waren es gewohnt sich zur Wallfahrt zu treffen. Dort trafen sich die Menschen aus der Stadt und der weiteren Umgebung, alle Generationen. Die Wallfahrten fanden schon seit dem Barock statt. Aber nicht nur das. Wenn Sie von Plan aus Richtung Kiesenreuth fahren und nach Westen blicken, liegt Ihnen das Grenzgebiet vom Kaiserwald bis zum Böhmerwald zu Füßen. Wenn Sie auf diese Landschaft blicken, wird Ihnen klar, dass jeder, der hier einmal gelebt hat, noch dazu hier geboren wurde, sehr leiden musste, als er gezwungen wurde, diesen Ort zu verlassen. Es ist also kein Wunder, dass die Planer Deutschen wenigstens diesen Ausblick hier her haben wollten. Ich denke, dass der symbolische Wert der Wallfahrten und des Bandes zwischen der alten und neuen Hl. Anna sehr groß ist. Und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt, auch wenn jemand z.B. nur als Tourist an der Wallfahrt teilnimmt.